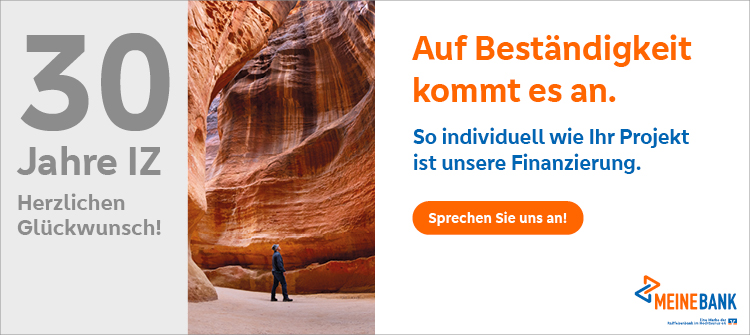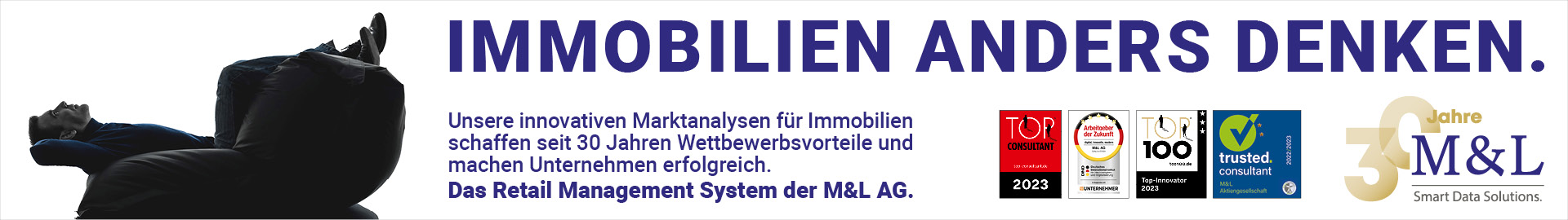Mein Land Dein Land
Text und Videos | Sabine Gottschalk Fotos | Oren Ziv*
*soweit nicht anders vermerkt

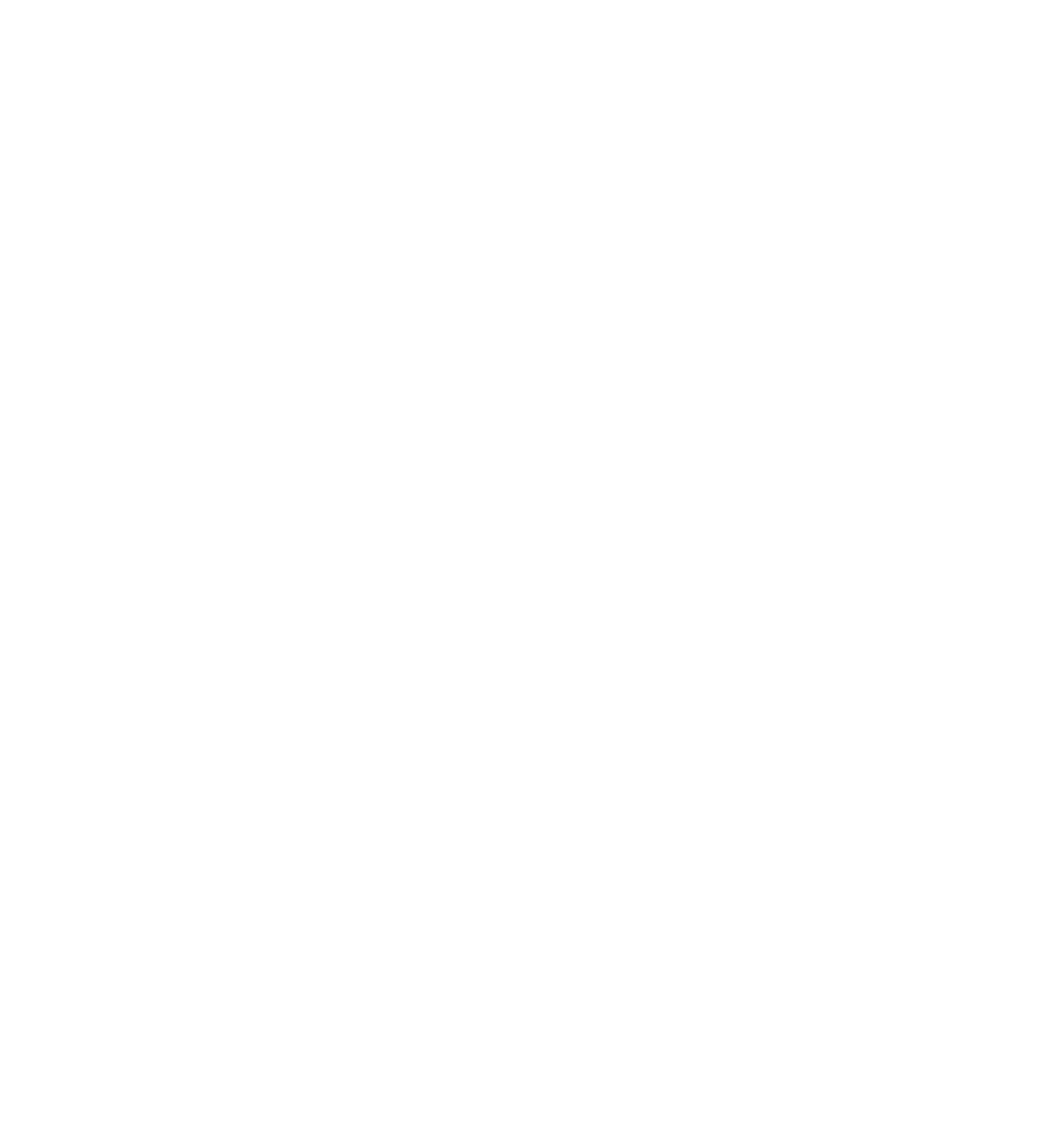

Mein Land Dein Land
Text und Videos | Sabine Gottschalk Fotos | Oren Ziv* *soweit nicht anders vermerkt

Unser Besuch im Westjordanland fand vor dem Angriff der Hamas im Süden Israels statt. Seit Beginn des Gaza-Kriegs hat sich das Leben der Gesprächspartner stark verändert. Väter und Söhne der israelischen Familien wurden eingezogen, palästinensische Familien sehen sich weitaus stärkeren Angriffen durch religiöse Fanatiker ausgesetzt als zuvor. Recherchen der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem zufolge wurde das Dorf Susya bei Hebron im Oktober mehrmals angegriffen, technische Geräte gestohlen oder zerstört. Bis zum Redaktionsschluss waren alle unsere Gesprächspartner unverletzt.
Es kocht in der Wiege des Judentums. Seit der Staatsgründung Israels 1948 ist das Westjordanland eines der am meisten umkämpften Gebiete weltweit. Palästinenser, die damals aus den Städten am Mittelmeer hierher vertrieben wurden, fürchten eine weitere Verdrängung durch die israelische Siedlungspolitik.
Wie man wohnt, lebt und überlebt, haben uns Bewohner von drei israelischen Siedlungen und drei palästinensischen Dörfern erzählt. Sie werden in getrennten Geschichten porträtiert, darauf haben beide Seiten großen Wert gelegt.
Die Naqba, die Vertreibung der Palästinenser aus den Küstenstädten im Jahr 1948, ist bis heute im kollektiven Gedächtnis des ganzen Volkes fest verankert. Niemand will sein Land an jüdische Siedler verlieren, Ausweichmöglichkeiten gibt es ohnehin nicht. Denn obwohl die vertriebenen Palästinenser jordanische Ausweispapiere haben, würde nicht einmal Jordanien sie aufnehmen. Gleichzeitig fordern orthodoxe Juden die Rückgabe biblischer Stätten. Das Westjordanland gehört für sie wie das heutige israelische Staatsgebiet als Gelobtes Land Eretz Israel dem jüdischen Volk. Das unterstreicht die von der aktuellen rechts-religiösen Regierung nicht nur geduldete, sondern gezielt geförderte Siedlungspolitik in Palästinensergebieten zwischen der mit einer Mauer gesicherten Staatsgrenze Israels, der sogenannten Grünen Linie, und dem Jordan.

Grundschule in der alten Siedlung Beit Horon zwischen Jerusalem und Tel Aviv.
Religiöse Juden, vornehmlich aus angelsächsischen Ländern, haben seit dem Ende des Sechstagekriegs 1967 immer wieder palästinensisches Land besetzt und so lange ausgeharrt, bis die israelische Regierung ihnen die Erlaubnis gab, eine eigene Siedlung zu errichten. Da in Palästina weder unter türkischer noch unter britischer oder jordanischer Herrschaft ein offizielles Kataster etabliert wurde, haben palästinensische Familien, die hier seit Jahrzehnten leben, keine Möglichkeit, ihren Besitz nachzuweisen. Das Land, auf dem sie leben, wird in großen Teilen treuhänderisch vom israelischen Staat verwaltet. Er hat damit die Möglichkeit, es jüdischen Siedlern zu überlassen. Die UN ächten den Landraub und sehen in der aktuellen Siedlungspolitik Israels eine Verletzung internationalen Rechts. Rund 7.000 neue Wohnungen sind dennoch allein im ersten Halbjahr 2023 genehmigt worden.
Mit rund 21.000 Quadratkilometern ist Israels offizielles Staatsgebiet etwa so groß wie Hessen. Die Bevölkerung wächst jährlich um etwa 1,6 % auf mittlerweile mehr als 9 Mio. Einwohner an. Bezahlbarer Wohnraum wird dringend benötigt, nicht nur Jerusalem und die Metropolregion Tel Aviv platzen aus allen Nähten.
Die einzige Demokratie des Nahen Ostens hat seit Jahresbeginn erstmals in 75 Jahren eine religiös geprägte Regierung. Ein Grund für diese Entwicklung ist die Zunahme der orthodoxen Bevölkerung, die sich durch die hohe Zahl ihrer Kinder in den vergangenen Jahrzehnten einen Mehrheitsvorteil geschaffen hat. Acht bis zehn Kinder pro Familie sind keine Seltenheit. Alle diese Menschen brauchen Wohnraum. Hinzu kommt der anhaltende Zuzug. Denn Alija, die Rückkehr ins Gelobte Land, ist die Zauberformel, die allen Menschen jüdischen Glaubens ein Leben in Israel ermöglicht.
Der Schutz der Siedlungen im Westjordanland durch israelisches Militär verlangt der Bevölkerung nicht nur finanziell große Opfer ab. In Israel gilt eine allgemeine Wehrpflicht, drei Jahre für Männer, zwei für Frauen. Manche Einsätze enden tödlich. Dennoch bestehen orthodoxe Juden auf einem Leben im Land ihrer Vorväter Abraham, Isaak und Jakob.

Trotz Räumung wird die Siedlung Homesh von ultra-orthodoxen Juden wieder aufgebaut.

Israelisches Militär schützt jüdische Siedler im arabischen Ost-Jerusalem.
Eine Zweistaatenlösung mit einem unabhängigen Palästina rückt damit in weite Ferne. Nicht nur Israel favorisiert einen einzigen Staat. Auch viele Palästinenser wollen das, allerdings unter der Bedingung, dass sie die gleichen Rechte bekommen wie jüdische Bewohner. Wegen einer befürchteten starken Bevölkerungszunahme auf Seiten der Palästinenser will Israel ihnen das jedoch nicht zugestehen.
Seit den Osloer Verträgen in den 1990er Jahren ist das Westjordanland in drei Zonen A, B und C eingeteilt. Die ersten, inzwischen mehr als 40 Jahre alten jüdischen Dörfer auf der östlichen Seite der israelischen Staatsgrenze liegen in Zone C unter israelischer Verwaltung. Sie sind zu gut funktionierenden Kommunen mit einer vorbildlichen Stadtplanung herangewachsen. Hier leben die Siedler und ihre arabischen Nachbarn fast friedlich nebeneinander. Doch damit gibt sich die nachfolgende Generation nicht zufrieden. Immer wieder entstehen neue Außenposten in der Nähe palästinensischer Städte und Dörfer wie Nablus oder Hebron in den Zonen A und B, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet werden. Die Outposts bieten dauernden Anlass für bewaffnete Auseinandersetzungen. Aggressiven Siedlern, die palästinensische Dörfer mit Steinen und Molotow-Cocktails angreifen, stehen nicht minder wütende junge Palästinenser gegenüber, die ebenfalls zu Waffen greifen. Häufiges Angriffsziel sind Autos mit israelischen Kennzeichen auf Transitstraßen.
Die heutigen Siedlungswilligen sind größtenteils bereits in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen. Das Land, auf dem sie sich niederlassen, wird nach gleichem Muster beschlagnahmt wie schon nach dem Ende des Sechstagekriegs 1967. Sobald Israel es zum „Staatsland“ erklärt, kann die Regierung es den Siedlungswilligen zur Bebauung übergeben. In einigen wenigen Fällen kommt dabei sogar Land unter den Hammer, dessen Besitz Palästinenser nachweisen können. Immer geht den arabischen Familien jedoch Land verloren, das sie als Weide für ihre Schaf- und Ziegenherden dringend benötigen. Für die jüdischen Siedler hingegen stellt sich nur ein Problem: Die Zahl der Banken, die Kredite zum Hausbau im palästinensischen Gebiet vergeben, ist aufgrund der Sicherheitslage gering. Wer als Projektentwickler gleich ein größeres zusammenhängendes Areal bebaut, geht hier hingegen kein Risiko ein, die Wohnungen sind schneller verkauft, als das Fundament gegossen ist.
Die neuen Flächen liegen seit jeher immer in der Nähe eines Außenpostens der Armee. Nur so können die Siedler vom Schutz der Soldaten profitieren. Dort warten sie so lange ab, bis sie eine Baugenehmigung für feste Häuser, Schulen und Synagogen erhalten. Auch für archäologische Grabungen im Westjordanland müssen Palästinenser weichen, wenn alttestamentarische Stätten gefunden werden. Dann werden ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht.
Um das Überleben der neuen Siedlungen zu garantieren, bekommen sie sofort Anschluss an das israelische Trinkwasser- und Stromnetz. Da die Palästinensische Autonomiebehörde nur begrenzte Kompetenzen hat, ist sie für einige Verwaltungsbereiche nicht zuständig. Die Wasserversorgung liegt in der Verantwortung der palästinensischen Verwaltung, doch für Strom sind palästinensische Dörfer auf Israel angewiesen.

In den regenarmen Bergen bei Hebron haben Schäfer ein kärgliches Auskommen mit ihren Herden.
Das bringt ganz praktische Probleme mit sich, wenn Reparaturen am Netz durchgeführt werden müssen. Denn einerseits dürfen Palästinenser nicht am israelischen Stromnetz arbeiten, andererseits dürfen Israelis nur in Ausnahmefällen die Zone A betreten. In der Regel ist selbst die Weiterfahrt auf einer Verbindungsstraße untersagt. In die Zonen B und C dürfen Israelis einreisen, da hier das israelische Militär für die Sicherheit zuständig ist. Doch auch hier herrscht die höchste Sicherheitsstufe und es gibt Straßen, die unter Siedlern aus Angst vor Anschlägen tabu sind.
In der Zone A liegen Städte wie Nablus und Jenin mit seinem großen Flüchtlingslager, die immer wieder Orte von Auseinandersetzungen sind. Unweit dieser Städte wurde im Mai die seit 2005 vertraglich aufgelöste Siedlung Homesh auf einem Hügel illegal zu neuem Leben erweckt und eine Jeschiwa - eine Toraschule - mit ministerieller Unterstützung eingeweiht. Religiöse Bildung wird so zur Gründung einer neuen Ansiedlung genutzt.
Nur wenige hundert Meter unterhalb des Hügels von Homesh leben die Bewohner des palästinensischen Dorfes Burqa in ständiger Angst vor Angriffen durch radikale Siedler, die sich nicht scheuen, Molotow-Cocktails in Scheunen zu werfen.
Besser sieht es in und um etablierte jüdische Städte wie Efrat in der Region Gusch Etzion aus. Nur etwa einen Kilometer vom Highway 60 und nicht weit von Bethlehem entfernt, erstreckt sich über mehrere Hügel eine nahezu perfekte Planstadt. Im Gegensatz zu den umliegenden palästinensischen Dörfern ist Efrat mittlerweile eine Stadt, die ihresgleichen sucht. „Wir haben seit 15 Jahren denselben Stadtplanungschef“, sagt Efrats Bürgermeister Oded Revivi. Das führe dazu, dass in seiner Stadt von Anfang an alles mitgedacht wird: Kindergärten, Schulen, Spielplätze, Synagogen für unterschiedliche Glaubensausrichtungen, medizinische Versorgung und Einkaufszentren. Im Supermarkt arbeiten Israelis und Palästinenser zusammen.
Die Siedlung ist dank guter Bewässerungssysteme wie einige andere auch zu einer prosperierenden Oase geworden. Doch Friede bedeutet das nicht. Auch hier müssen die Siedler immer um ihre Sicherheit fürchten. Die Gated Community ist umzäunt und mit Nato-Draht gesichert. Vor einigen Jahren hat hier eine Messerattacke durch einen palästinensischen Jugendlichen zu Todesopfern auf beiden Seiten geführt.

Diesen Artikel teilen