ESG-Check
für antike Arena
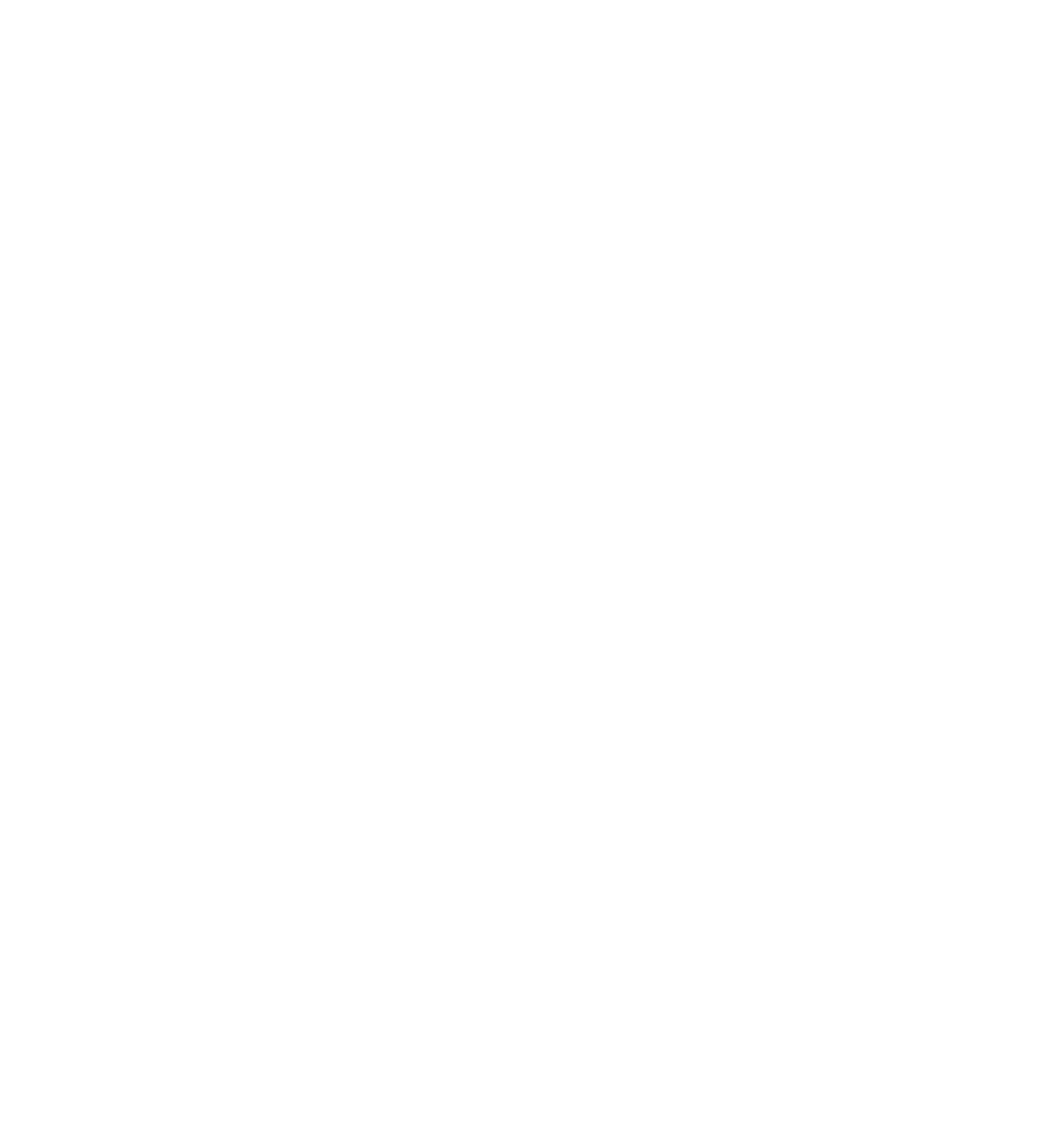
Text | Klaus Grimberg Fotos* und Video | Davide Marconcini
*soweit nicht anders vermerkt
Schauen Sie sich den Drohnenflug über das Amphitheater an zu den Klängen von Giacomo Puccini. Seine Werke werden in der Arena di Verona oft gespielt. Um die Musik zu hören, klicken Sie auf das Lautsprechersymbol unten im Footer.

ESG-Check
für antike Arena
Text | Klaus Grimberg Fotos* und Video | Davide Marconcini
*soweit nicht anders vermerkt
Schauen Sie sich den Drohnenflug über das Amphitheater an zu den Klängen von Giacomo Puccini. Seine Werke werden in der Arena di Verona oft gespielt. Um die Musik zu hören, klicken Sie hier
Die um 30 nach Christus errichtete Arena di Verona zieht mit ihrer einzigartigen Akustik die Opernfans aus aller Welt in den Bann. Ein solches Meisterwerk der Nachhaltigkeit müsste unter ESG-Kriterien eine Perle für jeden Immobilienfonds sein. Deshalb haben wir vor Ort alle notwendigen Ankaufsinformationen gesammelt und Robert Kitel, ESG-Experte bei Alstria in Hamburg, und Walter Seul, Fondsmanager bei Swiss Life KVG in Frankfurt, um eine Analyse gebeten. Wer von den beiden würde kaufen?
Die Arena di Verona ist ein architektonisches Meisterwerk aus der Frühzeit des römischen Kaiserreichs. Das Amphitheater entstand um 30 nach Christus, vollendet wurde es nach neuesten Forschungen aber wohl erst in der Regierungszeit des Kaisers Claudius (41-54 n. Chr.). Das antike Bauwerk und die Piazza Bra an seiner Westseite bilden heute das Herz der Altstadt. Im ersten Jahrhundert nach Christus lag das einst 152 Meter lange Oval allerdings außerhalb der römischen Stadtmauern nahe der Kreuzung zweier wichtiger Handels- und Heeresstraßen.

Die Konstruktion der Arena ist außergewöhnlich. Denn die Zuschauerränge für bis zu 30.000 Menschen, die sogenannten cavea, werden allein durch strahlenförmig nach innen verlaufende Wände und Gewölbe getragen. „Das Mauerwerk besteht aus einem Gemisch aus Schutt und Bauresten, gebunden durch Zement- oder Kalkmörtel“, erläutert Antonella Arzone, verantwortliche Kuratorin für die Monumente und kunsthistorischen Sammlungen der Stadt. Die Oberflächen wurden anschließend mit Ziegel- und Kieselsteinwerk verkleidet. „Die Gewölbe hingegen entstanden in der römischen Betontechnik in Holzschalungen, bei der verschiedene Steine mit Mörtel zu einer festen Masse vermischt wurden“, ergänzt Arzone.

Kitel: Einfache Konstruktion aus Bögen und Zwischenräumen, die mit vorhandenen Materialien aufgefüllt wurden. Sehr stabiles Tragwerk, das lange hält – perfekt. Beton wurde noch mehr als Kleber gedacht, weniger als Baustoff, der Wände erzeugt. So ist es genau richtig. Insofern bauen wir heute unsere Betonhäuser eigentlich aus Kleber.
Seul: Die gesamte Bauorganisation und -ausführung erscheint vorbildlich. Das konnten die Römer und im Grundsatz haben wir bis heute in dieser Hinsicht nicht viel Weiterentwicklung erlebt. Materialien und Techniken zu nutzen, die vorhanden sind – das kann man kaum besser machen.


Kitel: Einfache Konstruktion aus Bögen und Zwischenräumen, die mit vorhandenen Materialien aufgefüllt wurden. Sehr stabiles Tragwerk, das lange hält – perfekt. Beton wurde noch mehr als Kleber gedacht, weniger als Baustoff, der Wände erzeugt. So ist es genau richtig. Insofern bauen wir heute unsere Betonhäuser eigentlich aus Kleber.
Seul: Die gesamte Bauorganisation und -ausführung erscheint vorbildlich. Das konnten die Römer und im Grundsatz haben wir bis heute in dieser Hinsicht nicht viel Weiterentwicklung erlebt. Materialien und Techniken zu nutzen, die vorhanden sind – das kann man kaum besser machen.

Die imposante Außenfassade setzte sich aus drei übereinanderliegenden Arkadenreihen zusammen. Dafür nutzten die Erbauer rechtwinklige Blöcke des „Ammonitico Rosso“, eines in der Region weitverbreiteten Sandsteins, dessen Farbe zwischen Weiß- und Rottönen changiert. Unter Ausnutzung der Schwerkraft wurden die riesigen Quader geschickt gestapelt und lediglich durch kleine Metallstifte in der Mitte der jeweiligen Blöcke miteinander verbunden.

Kitel: Für das gesamte Bauwerk gilt: Wenige Materialien, gut auseinanderzunehmen, man zerstört dabei nicht die Baustoffe. Das ist einer der Kerngedanken der „circular economy“, schon damals komplett umgesetzt.
Seul: Das ist 2.000 Jahre alte Handwerkskunst – großartig! Das Ergebnis kann man sehen, bis heute.

Auch die Stufen der Ränge bestehen aus dem charakteristischen Sandstein, wurden jedoch seit dem 16. Jahrhundert mehrfach restauriert, weil sie entweder stark abgenutzt waren oder zwischenzeitlich als Materialsteinbruch für andere Gebäude in Verona dienten. „Das gilt genauso für den ursprünglich vorhandenen Außenring der Fassade, von dem heute nur noch ein kleines Stück erhalten ist, den die Veroneser ala – den Flügel – nennen“, erklärt Massimo Saracino, Konservator in den archäologischen Sammlungen, beim Rundgang um die Arena. Nahezu der gesamte Außenring wurde wohl schon im Jahr 489 n. Chr. auf Befehl des Ostgotenkönigs Theoderich abgerissen, um die Steine für den Ausbau der Stadtmauer zu nutzen. Noch immer lassen sich Bestandteile des einstigen Außenrings in vielen öffentlichen und privaten Gebäuden der Stadt nachweisen.

Kitel: Noch ein gutes Beispiel für „circular economy“ – die konsequente Wiederverwendung von Materialien. Spricht für die Qualität der Steine, die über Jahrhunderte genutzt werden können, bei Bedarf in kleinerem Format. Aber es wurde eben kein neues Material reingeholt, sondern mit dem gearbeitet, was da war.
Seul: Die Wiederverwendung gibt einen deutlichen Hinweis auf die hohe Wertigkeit der Materialien.

Die Sandsteinblöcke stammen aus der Region Valpolicella, 30 Kilometer nordwestlich von Verona. Der Transport erfolgte vermutlich mit Hilfe von Eseln oder Pferden, vielleicht auch per Schiff auf der Etsch. Genaue Quellen gibt es dazu nicht. Der Marmor für Skulpturen, Brunnen oder andere Dekorationen in der Arena kam aus weit entfernten Regionen, zum Teil aus dem heutigen Russland.
Kitel: Regionale Baustoffe, kurze Wege, wenig CO2 – das ist genau das, was man immer möchte! Transport aus CO2-Sicht gut, aus Menschen- und Tiersicht eher nicht so gut. Sehr viel Plackerei und vermutlich Sklavenarbeit. Da hätte ich ein sehr großes Fragezeichen, ob Arbeitsbedingungen und -sicherheit aus heutiger Sicht eingehalten wurden.
Seul: Diese Frachtlogistik ist nichts anderes als Sklavenarbeit. Da tue ich mich schwer, dem etwas Positives abzugewinnen. Das war eine furchtbare Schufterei, das ist in der heutigen Zeit zum Glück kein Thema mehr.



In der Stadt Pula, heute im kroatischen Teil Istriens gelegen, ist das dortige Amphitheater in Architektur und Bauweise nahezu identisch mit dem in Verona. Es ist allerdings etwas kleiner und etwas älter. „In der historischen Forschung legt das die Vermutung nahe, dass die in Pula angewandten Prinzipien auf Verona übertragen wurden – in vergrößertem Maßstab“, sagt Arzone.

Kitel: Klingt gut. Man lernt erst von kleineren Projekten und traut sich dann an größere. Offenbar haben sie vieles richtig gemacht, ansonsten wären die Bauwerke nicht mehr da.
Seul: Heute bräuchte man für solche Projekte Bauingenieure, Architekten, Statiker, Rechtsanwälte, Generalunternehmer, Finanzberater, um so etwas überhaupt zu planen. Früher brauchte es dafür gute Handwerker.

Offenbar gab es schon im ersten Jahrhundert nach Christus hochspezialisierte Baumeister, die durch das römische Reich zogen und sich ihr bautechnisches Wissen gut bezahlen ließen.
Kitel: Die Baumeister agierten wahrscheinlich auf der Entscheidungsebene. Aber schwere und gefährliche Arbeiten wurden mit Sicherheit von Sklaven ausgeführt. Für die lokale Wirtschaft ein langanhaltendes Projekt, das viel Arbeit und Wohlstand gebracht hat.
Seul: Auch damals gab es gewiss schon Bürokratie. Aber die stand in keinem Verhältnis zu dem, was wir heute tun, wenn wir vergleichbare Bauwerke planen – mit Vorlaufzeiten von fünf, zehn oder sogar 20 Jahren. Das war früher nicht notwendig und trotzdem steht das Gebäude nach 2.000 Jahren immer noch. Das ist natürlich ein etwas süffisanter Vergleich. Aber vielleicht sollten wir viel stärker hinterfragen, ob wir tatsächlich so viel Bürokratie brauchen.


Offenbar gab es schon im ersten Jahrhundert nach Christus hochspezialisierte Baumeister, die durch das römische Reich zogen und sich ihr bautechnisches Wissen gut bezahlen ließen.
Kitel: Die Baumeister agierten wahrscheinlich auf der Entscheidungsebene. Aber schwere und gefährliche Arbeiten wurden mit Sicherheit von Sklaven ausgeführt. Für die lokale Wirtschaft ein langanhaltendes Projekt, das viel Arbeit und Wohlstand gebracht hat.
Seul: Auch damals gab es gewiss schon Bürokratie. Aber die stand in keinem Verhältnis zu dem, was wir heute tun, wenn wir vergleichbare Bauwerke planen – mit Vorlaufzeiten von fünf, zehn oder sogar 20 Jahren. Das war früher nicht notwendig und trotzdem steht das Gebäude nach 2.000 Jahren immer noch. Das ist natürlich ein etwas süffisanter Vergleich. Aber vielleicht sollten wir viel stärker hinterfragen, ob wir tatsächlich so viel Bürokratie brauchen.

Dazu gehörte auch ein ausgeklügeltes Entwässerungssystem unter der Arena. Über bis heute sichtbare Rinnen wurden sämtliche Abwässer von den Rängen und aus den Gewölben in diese Kloake gespült und von dort in die Etsch geleitet.

Kitel: Damals gewiss ein Meisterwerk der Technik, der Zeit weit voraus. Bei ganztägigen Spektakeln waren diese Rinnen, die man mit Wasser durchspülen konnte, bestimmt dringend nötig.

Die Gladiatorenkämpfe, die bis in die erste Hälfe des 3. Jahrhunderts in der Arena ausgetragen wurden, waren ein- oder mehrtägige Spektakel, die hohe Würdenträger oder reiche Bürger ausrichteten. Besonders aufsehenerregend waren Duelle mit wilden Tieren, von denen der Großteil allerdings schon beim Transport verendete.

Kitel: Aus heutiger Sicht definitiv fragwürdig, allerdings muss man das natürlich im Kontext der Zeit vor 2.000 Jahren sehen. Ich nehme aber stark an, dass Felle oder Fleisch weiterverwendet wurden.
Seul: Was da auf dem Altar der Belustigung des Volkes geopfert wurde, darüber denkt man nie wirklich nach. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass diese Kämpfe in der Römerzeit kulturelle Ereignisse waren.

Nach dem Untergang des Römischen Reiches ging das Verständnis für die ursprüngliche Nutzung der Arena im öffentlichen Bewusstsein verloren. So entwickelte sich das große Oval im frühen Mittelalter zur Müllkippe und zum Steinbruch für die Veroneser. Die Gewölbe dienten als Wohnstätten, Handwerksbetriebe oder Marktstände, die Gegend um das Gebäude galt als verrufener Ort. Auch die Hinrichtung von 200 „Häretikern“ während der Inquisition im Jahr 1278 trug zum düsteren Bild bei.
Kitel: Das zeigt, wie multifunktional und anpassungsfähig so ein Gebäude sein kann. Was dauerhaft gebaut ist, kann selbst Falschnutzungen für ein paar Jahre oder sogar Jahrhunderte aushalten. Belegt auch, dass die Proportionen der Gewölbe gut durchdacht waren.
Seul: Der Mensch ist erfinderisch. Wenn ich Steine brauche und ich habe Steine guter Qualität in einem Gebäude, um das sich niemand kümmert, dann gibt es keine wirkliche Klärung der Frage, wem das gehört, und schon gar nicht, wie es genutzt werden darf.


Allerdings erließen die Regierenden der Stadt im 13. Jahrhundert erste Gesetze zum Schutz des Bauwerks, in denen vor allem Regeln für Bewohner der Gewölbe aufgestellt wurden. „Ab 1450 folgten unter venezianischer Herrschaft klare Statuten zum Schutz und zur Verwaltung des Gebäudes“, sagt Saracino. Mit der Renaissance ab dem frühen 16. Jahrhundert wurde dann die Arena als historisches Zeugnis „wiederentdeckt“. Die systematische archäologische und wissenschaftliche Erforschung setzte aber erst mit dem 18. Jahrhundert ein.
Kitel: Offenbar haben sie früh gespürt, welche große Wirkung das Bauwerk für die Stadt hat und dass es nicht einfach den Menschen überlassen werden kann. Die Regierung hat vorbildlich erfasst, dass sie das Gebäude schützen muss und dass es dafür Regeln braucht.
Seul: Das hat den endgültigen Verfall des Monuments verhindert. Was für ein Glück, dass solches Denken schon so frühzeitig eingesetzt hat, sonst wäre die Arena nicht in dieser Form erhalten geblieben.


Allerdings erließen die Regierenden der Stadt im 13. Jahrhundert erste Gesetze zum Schutz des Bauwerks, in denen vor allem Regeln für Bewohner der Gewölbe aufgestellt wurden. „Ab 1450 folgten unter venezianischer Herrschaft klare Statuten zum Schutz und zur Verwaltung des Gebäudes“, sagt Saracino. Mit der Renaissance ab dem frühen 16. Jahrhundert wurde dann die Arena als historisches Zeugnis „wiederentdeckt“. Die systematische archäologische und wissenschaftliche Erforschung setzte aber erst mit dem 18. Jahrhundert ein.
Kitel: Offenbar haben sie früh gespürt, welche große Wirkung das Bauwerk für die Stadt hat und dass es nicht einfach den Menschen überlassen werden kann. Die Regierung hat vorbildlich erfasst, dass sie das Gebäude schützen muss und dass es dafür Regeln braucht.
Seul: Das hat den endgültigen Verfall des Monuments verhindert. Was für ein Glück, dass solches Denken schon so frühzeitig eingesetzt hat, sonst wäre die Arena nicht in dieser Form erhalten geblieben.

Seit dem frühen 20. Jahrhundert ist die Arena di Verona in aller Welt als einzigartige Open-Air-Bühne für Opernaufführungen berühmt. Je nach Inszenierung finden zwischen 12.000 und 15.000 Zuschauer:innen auf Stühlen im Innenraum und den steinernen Rängen Platz. Von April bis Oktober reicht die Saison, tagsüber können Tourist:innen das historische Bauwerk besichtigen.
Für Verwaltung und Management der Arena gibt es eine eigenwillige Konstruktion. Die städtische Museumsdirektion organisiert den Museumsbetrieb und hat die Zuständigkeit für wissenschaftliche Forschungen und Veröffentlichungen rund um das Bauwerk inne. Seit Mitte der 1990er Jahre ist der Museumsverwaltung das „Ufficio del Conservatore dell’Anfiteatro Arena“ zur Seite gestellt, das für die laufende Instandhaltung und Sanierungsarbeiten verantwortlich ist. Zwischen November und März wird die Arena unter Anleitung der Museumsexpert:innen im historischen Originalzustand präsentiert.
Von April bis Oktober aber übt die „Fondatione Arena di Verona“ das Hausrecht aus. Diese städtische Stiftung agiert als Betreibergesellschaft der Opernfestspiele sowie anderer Konzerte und Aufführungen zu Beginn und am Ende der Saison. Über allen diesen Einrichtungen thront der staatliche Denkmalschutz, der bei baulichen und konservatorischen Entscheidungen zur Arena das letzte Wort hat. Wenn man sich mit Antonella Arzone und Massimo Saracino über die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure unterhält, lässt sich unschwer erahnen, dass es dabei immer wieder zu Konflikten kommt.

Kitel: Ein Gebäude, das nicht genutzt wird, verfällt. Dann hat man nichts gewonnen. Andererseits muss es so genutzt werden, dass der ursprüngliche Charakter nicht verloren geht. Dieser schwierige Spagat zeigt sich hier in den involvierten Parteien. Ich glaube, der Veranstalter könnte noch viel mehr machen und entsprechend höhere Gewinne erzielen. Deshalb ist es wichtig, dass noch jemand aus anderer Perspektive darauf schaut, um die Arena nicht auf Kosten späterer Generationen zu verheizen. Die unterschiedlichen Interessenlagen müssen gegeneinander abgewogen werden. Aber es ist gewiss nicht leicht, das genau auszutarieren.
Seul: Diese Konstruktion würde ich die totale Vollkatastrophe nennen. Widerstrebender könnten die Interessenlagen nicht sein. Dem Veranstalter geht es darum, seine Aufführungen mit maximaler Auslastung durchzuziehen, dafür braucht er Technik und Logistik. Der Museumsverwalter hingegen dreht jeden Stein um und schreit am Ende der Saison Zeter und Mordio, was wieder alles kaputt gegangen ist. Wenn ich eine Liegenschaft bekäme, die so organisiert ist, würde ich sofort sämtliche Verträge kündigen. Und sehen, dass ich eine einheitliche, an dem Objekt orientierte Verwaltung installiere. Diese Institution bekäme einen Beirat zur Seite gestellt, der aus den unterschiedlichen Interessenlagern besetzt wäre. Für den, der die Immobilie betreibt, müsste es klar definierte Guidelines geben.

Besonders deutlich zeigte sich das in einer langen Debatte 2016/17 um ein ausziehbares Dach, das bei Bedarf als dünne Membran über den Innenraum gezogen werden sollte. Damit wollten die Verantwortlichen vor allem gegen verregnete Sommer und damit einhergehende Umsatzeinbußen bei den Opernaufführungen gewappnet sein. Ein internationaler Wettbewerb wurde ausgelobt, aus dem das deutsche Architekturbüro von Gerkan, Marg und Partner als Sieger hervorging. Die Pläne für das Projekt lagen unterschriftsreif vor, als die oberste Denkmalbehörde ihre Zusage am Ende doch verweigerte und der erbitterte Streit um das Dach in einer Blamage für die Stadt endete.
Kitel: Je mehr Veranstaltungstechnik eingebaut würde, desto höher wäre der Anspruch, solche Investitionen zu nutzen, womöglich auch tagsüber. Vielleicht war genau das der Gedanke des Denkmalschutzes: Wir machen aus der Arena keine Mehrzweckhalle! Die Oper als Kunstform kann dennoch in der Arena auf ganz besondere Weise erlebt werden. Das ist die Qualität, die sie in Verona erkannt haben. Das Bauwerk wird genutzt und bleibt doch in seinem Charakter erhalten.
Seul: Auch ich täte mich mit einem solchen Dach schwer. Für mich käme es nur infrage, wenn dadurch die Erosion des Gebäudes verhindert werden könnte. Aber das scheint nicht nötig zu sein. Ich kann durchaus verstehen, dass der museale Charakter bei der Entscheidung obsiegt hat.



In einer guten Saison locken die Opernfestspiele in der Arena zwischen 450.000 und 500.000 Besucher an, bei Kartenpreisen von 32 bis 270 Euro. Daraus resultieren Einnahmen von etwa 30 Mio. Euro, hinzu kommen Förderungen aus staatlichen Kulturetats und Sponsorengelder. Bei 1.000 bis 1.300 Mitarbeitern während der Sommermonate und hohem Aufwand für die Bühnentechnik bleibt der Kulturbetrieb aber ein Zuschussgeschäft, im idealen Fall steht am Ende der Saison eine schwarze Null. Andererseits bescheren die Opernabende Hotels, Restaurants und Geschäften der Stadt einen jährlichen Umsatz von geschätzt 500 Mio. Euro. Auch ohne die Aufführungen bliebe die Arena nach dem Kolosseum und dem Forum Romanum in Rom und Pompeji die meistbesuchte antike Stätte in Italien.

Kitel: Man muss sich fragen: Welche Strahlwirkung hat das Gebäude für die ganze Region, wer lebt alles indirekt davon und generiert Steuereinnahmen, die letztlich wieder in den Erhalt des Bauwerks fließen? Dabei kann es nicht um kurzfristige Profite gehen. Die Arena war und ist ein Generationenprojekt.
Seul: Die entscheidende Frage bei der Strategie zur Nutzung ist: Was wollen wir eigentlich erreichen? Geht es darum, Geld zu verdienen, um die Kosten des Denkmalerhalts zu neutralisieren? Oder darf der Betrieb defizitär sein, weil er an anderer Stelle so sehr nutzt, dass das überkompensiert wird? Ich finde das Vorgehen der Stadt Verona gut. Man erhält die Arena und ermöglicht ein Spektakel, aber auf sehr hohem kulturellen Niveau.

Als Veranstaltungsort zeichnet sich die Arena dadurch aus, dass es in ihr kein Heizungs-, Kühl- oder Lüftungssystem gibt. Insofern benötigt das Gebäude sehr wenig Primärenergie. „Die Elektrik im Gebäude stammt allerdings zu großen Teilen noch aus den 1950er oder 1960er Jahren“, sagt Massimo Saracino beim Gang durch die Gewölbe der Arena. Bündel an Kabeln schlängeln sich in einem gigantischen Wirrwarr unter den Decken entlang. Nach vorsichtigen Schätzungen würde allein eine Modernisierung der Stromleitungen mindestens 10 Mio. Euro kosten, wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Wenig überraschend ist, dass es kein Smart Metering für das Gebäude gibt. Auch in Sachen Mülltrennung oder beim Wasserverbrauch in den teils sehr alten Toilettenräumen gibt es noch viel Luft nach oben. Kitel: Keine Heizung, Kühlung oder Lüftung: Die Arena ist ein Low-Tech-Gebäude, das mit sehr wenig Strom betrieben werden kann. Jedenfalls laufen Anlagen nicht das ganze Jahr durch und verbrauchen deshalb auch keine Energie. Aus ESG-Sicht optimal.
Seul: Ein Veranstaltungsraum für tausende Menschen, bei dem der direkte CO2-Footprint unglaublich niedrig ist. Es geht! Der Beweis ist geführt und das seit 2.000 Jahren! Die Elektrik widerspricht fundamental meinem Verständnis, wie zuverlässig Installationen in einem öffentlich genutzten Gebäude sein sollen. Ich halte diesen Zustand im 21. Jahrhundert für unhaltbar. Weil er schlicht und einfach gefährlich ist. Ich bin ein Fondsmanager von Immobilien, in denen Menschen leben. Sicherheit für die Gesundheit steht bei uns über allem.


Als Veranstaltungsort zeichnet sich die Arena dadurch aus, dass es in ihr kein Heizungs-, Kühl- oder Lüftungssystem gibt. Insofern benötigt das Gebäude sehr wenig Primärenergie. „Die Elektrik im Gebäude stammt allerdings zu großen Teilen noch aus den 1950er oder 1960er Jahren“, sagt Massimo Saracino beim Gang durch die Gewölbe der Arena. Bündel an Kabeln schlängeln sich in einem gigantischen Wirrwarr unter den Decken entlang. Nach vorsichtigen Schätzungen würde allein eine Modernisierung der Stromleitungen mindestens 10 Mio. Euro kosten, wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Wenig überraschend ist, dass es kein Smart Metering für das Gebäude gibt. Auch in Sachen Mülltrennung oder beim Wasserverbrauch in den teils sehr alten Toilettenräumen gibt es noch viel Luft nach oben. Kitel: Keine Heizung, Kühlung oder Lüftung: Die Arena ist ein Low-Tech-Gebäude, das mit sehr wenig Strom betrieben werden kann. Jedenfalls laufen Anlagen nicht das ganze Jahr durch und verbrauchen deshalb auch keine Energie. Aus ESG-Sicht optimal.
Seul: Ein Veranstaltungsraum für tausende Menschen, bei dem der direkte CO2-Footprint unglaublich niedrig ist. Es geht! Der Beweis ist geführt und das seit 2.000 Jahren! Die Elektrik widerspricht fundamental meinem Verständnis, wie zuverlässig Installationen in einem öffentlich genutzten Gebäude sein sollen. Ich halte diesen Zustand im 21. Jahrhundert für unhaltbar. Weil er schlicht und einfach gefährlich ist. Ich bin ein Fondsmanager von Immobilien, in denen Menschen leben. Sicherheit für die Gesundheit steht bei uns über allem.

Der Strombedarf für die Kulturveranstaltungen wird wegen der veralteten Elektrik komplett über temporäre Leitungen zum öffentlichen Netz mit dem herkömmlichen Energiemix geregelt. Bei den Opernabenden beschränkt sich der Verbrauch auf die Licht- und Tontechnik, die im Vergleich zu Rock- und Popkonzerten eher bescheiden ausfällt. Allerdings wird in jedem Jahr ein riesiger Aufwand beim Auf- und Abbau der Bühne und der Veranstaltungslogistik betrieben. Sämtliche Bühnenelemente, die großformatigen Bühnenbilder und die tribünenartigen Sitzreihen für die unteren Ränge werden mit einem Lastenkran in die Arena gehoben und am Ende der Saison wieder abmontiert. Auf der Rückseite des Ovals entsteht vorübergehend ein Containerdorf, in dem sich Solisten und Statisten umziehen und in den Pausen aufhalten. Die Bühnenaufbauten für die verschiedenen Inszenierungen werden an den Wochenenden täglich gewechselt, allabendlich ein logistischer Kraftakt. Für einzelne Aufführungen werden sogar Reitpferde zur Arena gebracht und nach der Vorstellung wieder abtransportiert.

Kitel: Technik wird nur dann reingenommen, wenn sie auch benötigt wird. Vergleichbare Mehrzweckhallen funktionieren nur, wenn sie das ganze Jahr über bespielt werden. Der CO2-Verbrauch bei der Vorbereitung ist zwar relativ hoch, aber auch nicht höher als bei großen Open-Air-Veranstaltungen auf der grünen Wiese. Hier sind wir mitten in der Stadt, die Leute kommen zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln; drumherum sind Hotels und Restaurants, also eine funktionierende Infrastruktur, die genutzt wird.
Seul: Dennoch ist der CO2-Footprint vergleichsweise klein. Eine Sportveranstaltung mit 2.000 Zuschauern in einer modernen Halle erzeugt nach meiner Einschätzung mehr CO2 als ein Opernabend in der vollbesetzten Arena.

Auch ein beträchtlicher Teil des Publikums wird mit Reisebussen aus den Urlaubsorten am Gardasee und den umliegenden Ferienregionen nach Verona gefahren und wieder abgeholt.
Andere, die in der Stadt eine Unterkunft gefunden haben, sitzen dann längst in einem der Restaurants an der Piazza Bra und lassen den Abend ausklingen. Ein Glas Wein aus dem Valpolicella, eine Verdi-Melodie im Ohr, der spektakuläre Blick auf die Arena: Viel mehr mediterranes Lebensgefühl geht nicht. Kitel: Ließe sich deutlich verbessern: Busse könnten nach und nach auf Elektrobetrieb umgerüstet werden, das würde der gesamten Region guttun. Denn immer mehr Urlauber wollen, dass ihr touristischer Fußabdruck kleiner wird.
Seul: Der indirekte CO2-Footprint der Arena ist nicht so gut, denn Besucher kommen nicht nur mit Bussen, sondern auch mit Autos und Flugzeugen nach Verona. Aber das ist das Wesen solcher Veranstaltungen. Immerhin hat der Veranstaltungsort einen sehr niedrigen Footprint.

v.l.n.r.: Antonella Arzone, Massimo Saracino, Klaus Grimberg

Fazit
Diesen Artikel teilen

