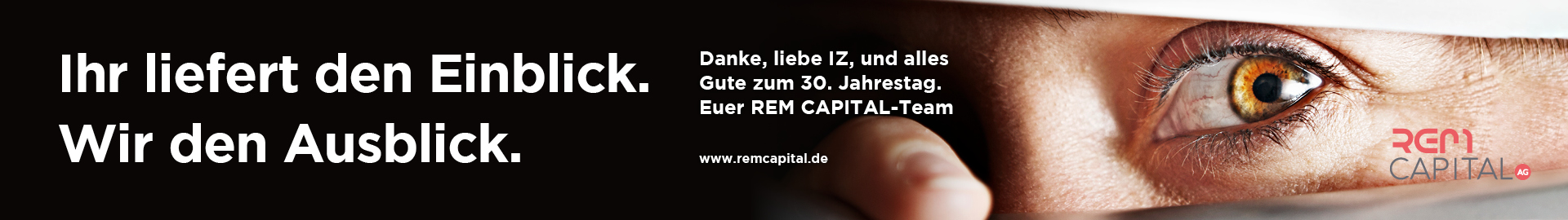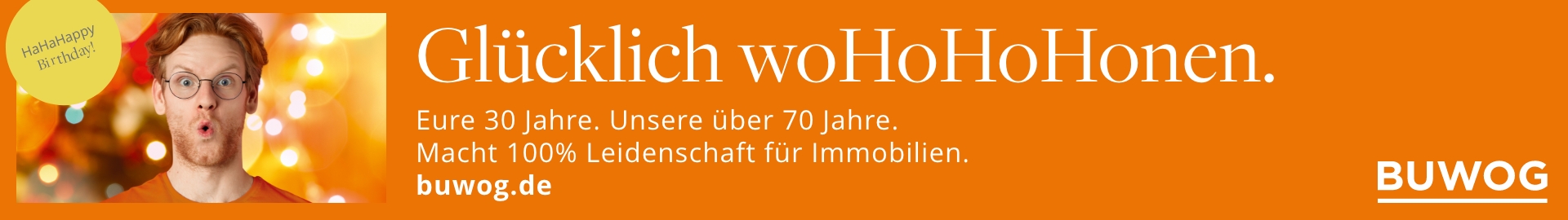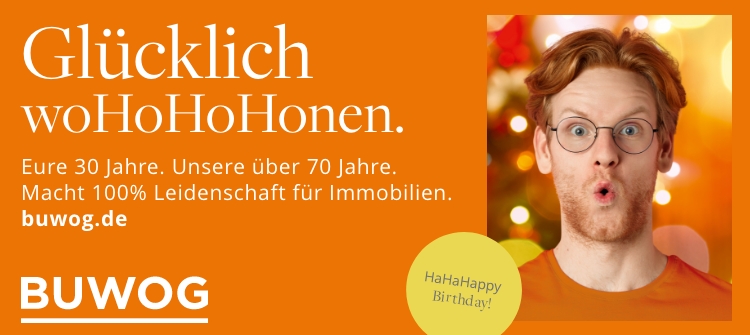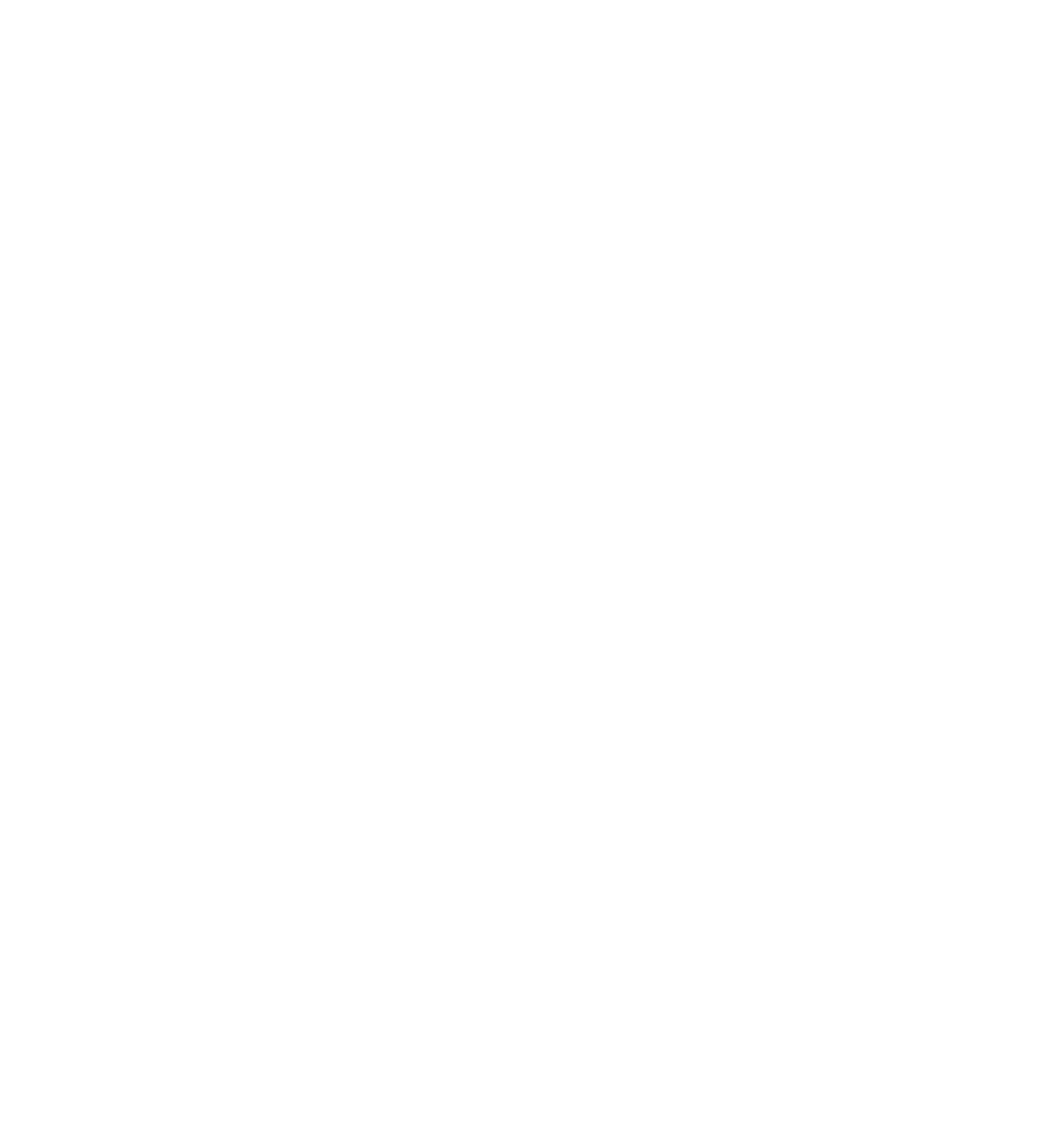
The Maze
Text | Thomas Porten
Mitten in den Favelas von Rio de Janeiro, mit Blick auf den berühmten Zuckerhut, hat der britische Lebenskünstler Bob Nadkarni ein einzigartiges Gebäude errichtet: The Maze – das Labyrinth. Verziert mit bunten Mosaiken wurde es zur Heimat von Künstlern aus aller Welt. Doch seit Jahrzehnten tobt um das mehrstöckige Haus ein erbitterter Kampf.
The Maze
Text | Thomas Porten
The Maze bietet einen spektakulären Blick auf den Zuckerhut. Foto: Ian Cheibub
Mitten in den Favelas von Rio de Janeiro, mit Blick auf den berühmten Zuckerhut, hat der britische Lebenskünstler Bob Nadkarni ein einzigartiges Gebäude errichtet: The Maze – das Labyrinth. Verziert mit bunten Mosaiken wurde es zur Heimat von Künstlern aus aller Welt. Doch seit Jahrzehnten tobt um das mehrstöckige Haus ein erbitterter Kampf.
„Sie kamen mit Stoßtrupps. Männer mit Maschinenpistolen, Helmen und Schutzschilden. Wir wurden aus unserem eigenen Haus hinausgeworfen, ich, meine Frau und meine Kinder. Und das alles nur, weil der Schleimsack von nebenan behauptet hat, dass das Haus einsturzgefährdet ist.“ Bobs Gesicht wird immer röter. Sein Schnauzbart, eine buschige Hommage an Salvador Dalí, zittert. Wild gestikulierend schimpft der 79-jährige Brite immer lauter: „Und dann steht dieser Betrüger da und heuchelt, wie leid ihm das alles tut. Wie es sein Herz bricht, dass wir nun ausziehen müssen. Verdammt, was für ein Drecksack.“ 2019 war das, aber es war nur eine der Schlachten, die Bob hier austragen musste. „Hier“ meint Tavares Bastos, eine eher kleine Favela unter den insgesamt vielleicht 1.000 vernachlässigten Vierteln in Rio de Janeiro. Wie viele dieser unsystematisch bebauten und nur mangelhaft an die öffentliche Infrastruktur angeschlossenen Gebiete es wirklich gibt, kann niemand genau sagen. Die kleineren beherbergen nur mehrere Hundert Bewohner, die größeren mehr als 100.000. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 20% der knapp 14 Millionen Einwohner Rios in einer Favela leben. Was alle eint, ist, dass man dort zwar bauen, aber legal kein Grundstück kaufen kann.
Inmitten der einfachen Häuser der Favelas steht The Maze (siehe Pfeil). Video: Ian Cheibub
„Sie kamen mit Stoßtrupps. Männer mit Maschinenpistolen, Helmen und Schutzschilden. Wir wurden aus unserem eigenen Haus hinausgeworfen, ich, meine Frau und meine Kinder. Und das alles nur, weil der Schleimsack von nebenan behauptet hat, dass das Haus einsturzgefährdet ist.“ Bobs Gesicht wird immer röter. Sein Schnauzbart, eine buschige Hommage an Salvador Dalí, zittert. Wild gestikulierend schimpft der 79-jährige Brite immer lauter: „Und dann steht dieser Betrüger da und heuchelt, wie leid ihm das alles tut. Wie es sein Herz bricht, dass wir nun ausziehen müssen. Verdammt, was für ein Drecksack.“ 2019 war das, aber es war nur eine der Schlachten, die Bob hier austragen musste. „Hier“ meint Tavares Bastos, eine eher kleine Favela unter den insgesamt vielleicht 1.000 vernachlässigten Vierteln in Rio de Janeiro. Wie viele dieser unsystematisch bebauten und nur mangelhaft an die öffentliche Infrastruktur angeschlossenen Gebiete es wirklich gibt, kann niemand genau sagen. Die kleineren beherbergen nur mehrere Hundert Bewohner, die größeren mehr als 100.000. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 20% der knapp 14 Millionen Einwohner Rios in einer Favela leben. Was alle eint, ist, dass man dort zwar bauen, aber legal kein Grundstück kaufen kann.
The Maze bietet einen spektakulären Blick auf den Zuckerhut. Foto: Ian Cheibub
Inmitten der meist nur mit schmalen Ziegelsteinen errichteten und häufig unverputzt gelassenen einfachen Häuser steht das außergewöhnliche Refugium von Bob. Wie üblich in den überfüllten Ansiedlungen in den Hügeln rund um das Zentrum der brasilianischen Hauptstadt, stützt es sich zum Teil auf die darunter liegenden Häuser. Über drei Stockwerke reicht sein Bauwerk. Bunte Mosaiken im Inneren verkleiden Böden, Wände, sogar Tische und Stühle. Überwältigend ist der Blick: Er richtet sich direkt auf das Meer und den Pão de Açúcar, den weltbekannten Zuckerhut – eine Idylle wie auf einer Ansichtskarte. Doch hinter der Idylle muss Bob sich wehren gegen lokale Drogenbanden, korrupte Polizisten, habgierige Nachbarn und rücksichtslose Immobilienspekulanten.

Bob hat seinem Nachbarn eine Zeichnung gewidmet: „Burn In Rage Alelluyah!“ Foto: Thomas Porten
Bob hat seinem Nachbarn eine Zeichnung gewidmet: „Burn In Rage Alelluyah!“ Foto: Thomas Porten
In den 1960er Jahren ist die Welt von Bob noch in Ordnung. Da hängt er mit Charlie Watts von den Rolling Stones und Ray Davis von den Kinks ab. Mit Shirley, der Frau von Watts, besuchte er das Hornsey College of Arts. Geboren wird Bob 1943 in Swindon. Von seinem indischen Vater erhält er den Nachnamen Nadkarni. Und Prügel. „Er hat mich missbraucht. Er war ein Tyrann, die zentrale Dunkelheit in meinem Leben“, erzählt er heute. Erst auf der Kunstschule fühlt er sich frei. „Hier konnte alles passieren.“ Tatsächlich erhält er das Angebot, eine Professur an einer Hochschule anzunehmen. „Aber ich hasste Lehrer, genauso wie ich schon die Grundschule gehasst habe.“ Zufällig stolpert er über die Anzeige: „Wanted Sculptor for the film 2001 – a space odyssey“. Seine Bewerbung ist erfolgreich und nun hilft er Stanley Kubrick, die Raumschiffe für dessen ScienceFictionFilm zu konstruieren. „Es war ein phantastischer Job und wir haben unglaublich viel Geld verdient.“ Danach folgen andere Jobs in der Filmproduktion und für Tonstudios. So lernt er Jimmy Hendrix, Bob Dylan und Miles Davis kennen.
Nach Brasilien verschlägt es Bob 1972 nur aus Zufall. „Meine Ehe zerbrach und ich nahm einfach das erste Schiff, das mich weg von England brachte.“ Statt in Ecuador muss das Schiff wegen eines Motorschadens in Brasilien Halt machen. „Es war Karneval, überall Halbnackte und Verkleidete. Hier wollte ich bleiben.“ Mehrere Monate geht dies gut. Dann greift ihn das Militär auf und wirft ihn aus dem Land.
Der Hausherr mit Schnauzer. Im linken Auge Rio bei Nacht, im rechten Rio am Tag. Foto: Ian Cheibub
Aber er will zurück. Zunächst verdingt er sich im Nahen Osten als Kameramann. In Berlin organisiert er eine Performance, bei der Paaren, die hinter einer Leinwand Sex hatten, der Puls gemessen wurde. „Wir hatten eine lange Schlange von Freiwilligen.“ Währenddessen lernt er Portugiesisch, berichtet für NBC über die Revolution in Portugal und kann dann endlich 1979 als internationaler Korrespondent für United Press International zurück nach Brasilien. Dort bezieht er ein Haus an der Copacabana. Für die Favelas interessiert er sich kaum. Das ändert sich zwei Jahre später, als seine Haushälterin erkrankt und er sie nach Hause bringt, hoch auf einen Hügel über Rio. „Ich öffnete das Fenster und sagte: Wow! Was für ein Ausblick!“ Aus dem staunenden „Wow“ wird ein Plan: „Hier werde ich mein Studio und eine Kunstgalerie bauen. Und wenn ich mit dem Filmen aufhöre, werde ich wieder mit dem Malen beginnen.“
Blick von den Hügeln der Favela Tavares Bastos auf Innenstadt und Meer. Foto: Ian Cheibub
Auf dem Hügel stehen nur wenige Gebäude. Eine verlassene Kaffeefarm, ein alter Kuhstall und ein paar Holzhütten. Einige Arbeiter mit ihren Familien haben sich angesiedelt, nachdem der vorherige Besitzer in sein Heimatland Portugal zurückgegangen war. „Als ich dorthin kam, lebten da ungefähr 400 Leute. Die Ortsansässigen fragten mich, den reichen Gringo, ob ich ihnen nicht ein Sozialzentrum bauen könnte. Und mein Studio dürfte ich dann darüber errichten.“
Bob stürzt sich in das Projekt. „Ich bin einfach in die Bücherei und habe alles kopiert, was ich über Hausbau und Statik finden konnte.“ Die Arbeit ist mühsam. Zum Hügel hinauf wird die Rua Tavares Bastos immer enger, irgendwann können nur noch Mopeds fahren und schließlich passen selbst Fußgänger kaum hindurch. Die 50-Kilo-Säcke mit Zement und Sand schleppt er auf seinem Buckel nach oben, ebenso die Ziegelsteine. „Die Leute hielten mich für verrückt, weil ich so viel Material für dicke Mauern verschwendet und nicht so dünne Ziegelwände hochgezogen habe wie sie. Aber ich wollte höher bauen, bis ich ganz oben bin, wo das Licht ist.“


Foto: Thomas Porten


Foto: Thomas Porten
Einen Bauplan hat er nicht. Er findet seine Inspiration in der malerischen Landschaft Rios. „In den hiesigen Wäldern lassen die Äste das Sonnenlicht auf unterschiedlichen Höhen hindurchscheinen, also wollte ich an einigen Stellen Oberlichter einsetzen. Weiter oben im Gebäude folgen asymmetrische Bögen, die die Form der Berge nachahmen. Die Wände sind geschwungen wie die Meeresbuchten.“ Das natürliche Chaos wird zum Bauprinzip. Das Grundstück gehört ihm nicht, denn das meiste Land in den Favelas steht in öffentlichem Eigentum und wird nicht verkauft. Wer darauf baut, handelt illegal. Trotzdem werden die Häu ser in den Favelas gekauft und verkauft. Erst viele Jahre später unternimmt die Stadtregierung Schritte, um bestehende Häuser durch Grund bucheintragungen zu legalisieren. Die Bauarbeiten schreiten nur langsam voran. Drei Jahre nach Beginn heiratet er Stella und Mitte der 80er Jahre wird ihr Sohn Bruno in den Favelas geboren. Bob findet einen Job bei der BBC. Seine Frau, sie wohnt nicht auf den Hügeln, ist gegen den Plan, eine Bildergalerie zu er öffnen. „Wer soll denn in so eine Gegend kom men?“ Bob wischt alle Argumente beiseite, er will die Menschen aus den zwei Welten Rios – die da oben und die da unten – über sein Kunst projekt vereinen. Die hohe Kriminalitätsrate in der Umgebung schreckt ihn nicht ab.
„Die Gegend wurde von einer Drogengang kontrolliert“, erinnert er sich. „Aber sie haben mich immer mit Respekt behandelt. Vermutlich aus Angst, was passiert, wenn sie einem BBC Korrespondenten etwas antun.“ Hilfe von der Polizei kann er ohnehin nicht erwarten. „Wenn die hierhinkommen, dann nur zum Stehlen.“ Er selbst habe zwei von ihnen ans Messer geliefert, indem er sie bei Erpressungsversuchen und dem Eintreiben von Drogengeldern heimlich auf gezeichnete hatte. Bei der Drogengang stieß das zwar nicht gerade auf Gegenliebe, aber nachdem einer der jungen Männer, die er früher unter stützt hatte, zum Henker der Gang wurde, stand er unter besonderem Schutz. „Der letzte, der mich bedroht hat, wurde kurz danach mit 78 Einschusslöchern auf einer Müllhalde gefunden.“ So erzählte es Bob zumindest einem Journalisten des Magazins Vice.
Im Jahr 1997 eröffnet die Kunstgalerie als erste ihrer Art in einer Favela. Sie erhält den Namen The Maze – das Labyrinth. Dieser Name spiegelt nicht nur die verwinkelten Straßen in den Fave las und die komplexe Architektur des Gebäudes wider, sondern auch die vielen Wege, die Bob selbst gegangen ist, um bis hierher zu gelangen.
Zur Eröffnung erscheint die lokale Politprominenz. Es wird sogar ein Film über das Gebäude gedreht, der bei einem nationalen Filmfestival einen Preis gewinnt. Mit der steigenden Bekanntheit gerät das Gebäude in den Fokus international tätiger Kreativer. Es werden Musikvideos gedreht, Telenovelas nutzen es als Drehort, es finden Fotoshootings für die Modebranche statt. „Shoot without being shot“ – unter diesem Slogan vermarktet Bob seinen Treffpunkt.
Trotz dieser ironischen Anspielung weiß auch der Brite, dass Tavares Bastos nicht vor einer Zunahme der Gewalt sicher ist. Andere Gangs aus benachbarten Vierteln könnten das vergleichsweise kleine Gebiet rücksichtslos übernehmen. Bei einer internationalen Pressekonferenz des Gouverneurs des Bundesstaats Rio de Janeiro, in der dieser seine Erfolge bei der Stabilisierung der Sicherheitslage feiert, kritisiert Bob deshalb lautstark die hohe Kriminalitätsrate. Im anschließenden Schlagabtausch präsentiert Bob einen Plan, nach dem in einem großen, leer stehenden Gebäude in seiner direkten Nachbarschaft eine Polizeistation der Bope entstehen könnte. Die Spezialeinheit, deren Emblem aus einem durchdolchten Totenschädel mit zwei Musketen besteht, gilt als äußerst brutal, aber nicht korrumpierbar. Der Gouverneur prüft den Plan und tatsächlich ziehen nach einiger Zeit 400 Mann der schwerbewaffneten Truppe in Bobs Nachbarschaft. Die Drogengangs verlassen Tavares Bastos, das Viertel beginnt zu erblühen und wird zu einem beliebten Wohnort.
Bobs Privatleben schlägt dagegen wieder Haken. Die Ehe mit Stella zerbricht und er heiratet die wesentlich jüngere Malu. Im Jahr 2001 kommt Tochter Lucy zur Welt, gefolgt von seinem vierten Kind Eric zwei Jahre später. „Da dachte ich, verdammt, Du bist jetzt 60 Jahre alt. Es wird Zeit, Geld für Deine Familie zu verdienen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte Bob bereits die BBC verlassen und auch sein Produktionsstudio aufgegeben. „Ich habe mich dann entschieden, ein Bed & Breakfast zu eröffnen. Hier hingen sowieso ständig Leute rum, die nicht mehr weggehen wollten.“

Das verwinkelte Maze: Im Inneren mit Mosaiken geschmückt, die Außenfassade einfach verputzt. Foto: Ian Cheibub

Die großen Bilder – hier eine ermordete Frau – hat Bob in früheren Jahren gemalt. Foto: Thomas Porten

Das verwinkelte Maze: Im Inneren mit Mosaiken geschmückt, die Außenfassade einfach verputzt. Foto: Ian Cheibub

Die großen Bilder – hier eine ermordete Frau – hat Bob in früheren Jahren gemalt. Foto: Thomas Porten
2005 geht es mit dem Übernachtungsangebot los. In den eher schlichten Zimmern finden etwa 30 Personen Platz. Ein Jahr später sind die deutschen Brüder und Jazzmusiker Wolfram und Lennart Goebel zu Gast, zusammen mit anderen Musikern. Es wird viel getrunken, gefeiert und musiziert. „Die erste Jazz-Nacht von vielen war im Grunde ein kompletter Unfall, aber ab da fan den sie regelmäßig statt.“ Bis zu 500 Besucher am Abend finden sich zu den Happenings ein. Bob selbst spielt Gitarre und singt, lernt ein paar Jahre später sogar Trompete. Das Magazin DownBeat zeichnet The Maze mehrfach als einen der besten Jazz-Orte weltweit aus. Sein Sohn Bruno eröffnet ein kleines indisches Restaurant im Haus. Einmal die Woche wird aufgetischt. „Und dieses Lassi war einfach so verdammt gut. Besonders, wenn man etwas Cacha-ca hineinkippt.“ 2008 wird The Incredible Hulk mit Edward Norton in Rio gedreht und die Filmcrew kehrt bei Bob ein. Snoop Dogg und Pharrell Williams nehmen das Musikvideo für den Song „Beautiful“ dort auf. Verschiedene Shootings, u.a. für einen Pirellikalender, finden statt.
Zu diesem Zeitpunkt ist Tavares Bastos auf etwa 2.000 Einwohner angewachsen. Rio platzt aus allen Nähten. Und mit der Entscheidung, dass Brasilien 2014 die Fußball-Weltmeisterschaft austragen darf, richtet sich der Blick von Immobilienspekulanten zunehmend auf die Favelas in der Nähe der Innenstadt. The Maze bleibt davon nicht verschont. Bob erhält im Jahr der WM von der Stadt die Anweisung, sein Gebäude zu schließen. „Ein Nachbar, der für die Stadt arbeitet, hatte uns denunziert. Wir würden mit Drogen handeln, hier gebe es Kinderarbeit, das Gebäude sei einsturzgefährdet und wir würden alle Bewohner gefährden.“ Von Bob zuvor eingereichte Architektur- und Ingenieurpläne, die die Sicherheit des Hauses bestätigten, sind plötzlich nicht mehr auffindbar.

Obwohl der Zugang zum Maze so eng ist, musste eine Auffahrt für Rollstuhlfahrer gebaut werden. Foto: Thomas Porten

Foto: Ian Cheibub
Links: Obwohl der Zugang zum Maze so eng ist, musste eine Auffahrt für Rollstuhlfahrer gebaut werden. Foto: Thomas Porten
Foto Rechts: Ian Cheibub
Er erhält eine lange Liste von baulichen Anforderungen, die er vor einer Wiedereröffnung erfüllen muss. Wegen der hohen Kosten startet Bob ein Crowdfunding-Projekt und bittet auf Facebook um Unterstützung, garniert mit einem Foto von ihm und Silvester Stallone: „Wir sind bereit, uns mit dem verrückten, eifersüchtigen Nachbarn auseinanderzusetzen. Lasst die Bösewichte nicht gewinnen!“ 57.000 britische Pfund, so seine Schätzung, müsse er einnehmen. „Ich muss jetzt überall Notausgänge einbauen und Rampen für Rollstühle anlegen“ – eine unsinnige Investition angesichts des engen Zugangs in die Favela.
Die Schikanen durch die Behörden gehen weiter. „Ich sollte einen Brandschutzplan von einem Spezialisten erstellen lassen. Das habe ich für viel Geld getan – aber nichts ist passiert. Warum? Weil ich im Formular eine Grundstücksnummer hätte eintragen sollen. Die gibt es aber nicht. Niemand hier hat eine.“ Anfang 2015 wird der Abriss des Gebäudes angeordnet. Bob fühlt sich verfolgt. „Die Fläche hier oben ist riesig, sie ist Milliarden wert. Man könnte dort eine kleine Stadt bauen und irgendjemand könnte sehr reich damit werden. Aber sie kommen nicht ran, weil der verdammte Gringo im Weg ist.“

Mit der Gemäldegalerie begann der Bau von The Maze. Foto: Ian Cheibub
Tatsächlich intensiviert sich in dieser Zeit der Kampf um die Grundstücke. Rio hat nach der Fußball-WM auch den Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele 2016 erhalten. Viele Baufirmen wittern das große Geschäft. Zwangsumsiedlungen sind keine Seltenheit, um den Bau von Sportstätten sowie angrenzende Luxusviertel zu ermöglichen. Entschädigungszahlungen sollen die Bevölkerung beruhigen, doch viel Geld gibt es nicht. 2016 kommt es zum Knall.

Eine ewige Baustelle: Seit Jahrzehnten wird am und im Maze gewerkelt. Foto: Thomas Porten
In diesem Jahr wird die Präsidentin des Landes, Dilma Rousseff, ihres Amtes enthoben. Ihr wird die Verantwortung für zahlreiche Korruptions skandale angelastet, in die sie selbst sowie Mitglieder ihrer Regierung verwickelt sind. Im Zentrum steht der halbstaatliche Ölkonzern Petrobas, der von zahlreichen großen Baufirmen geschmiert worden sein soll. In der Folge werden gegen Dutzende Politiker Ermittlungsverfahren wegen Korruption, Bestechung, Betrug und Geldwäsche eröffnet, fast 200 Personen landen im Gefängnis. Es ist eine schlechte Zeit für korrupte Beamte, aber eine gute für Bob: Man lässt ihn in Ruhe. „Die Politiker sind jetzt alle damit beschäftigt, sich vor dem Gefängnis zu verstecken“, freut er sich. Obwohl immer noch verboten, organisiert er wieder JazzAbende im Maze. Auch die Wer bung für das Bed & Breakfast läuft von Neuem an. Sonntags serviert sein Sohn Curry und die Zeitschrift Vogue ist für ein Fotoshooting da. Überflüssige Baumaterialien, die bisher aus Platz gründen sein Atelier blockiert haben, kommen weg. Bob will wieder mit dem Malen beginnen. „Endlich habe ich mein Haus zurück. Das Leben ist großartig!“
Freiwillige Helfer arbeiten an den Mosaiken. Foto: Thomas Porten
Und noch etwas geht voran: die Verkleidung eines großen Teils der Flächen mit bunten Mosaiken. Damit hat er 2016 begonnen, zunächst mit den Fußböden. Tausende zerbrochene Fliesenstückchen fügen sich in allen Farben zu sammen. Fische schwimmen durch die Wellen. Käfer, Schlangen, Krebse und Tintenfische bevölkern die Wände. Sein Sohn Bruno wird als Koch mit indischem Turban verewigt und der Meister selbst thront halbnackt im Schneidersitz über einem kleinen Wasserbassin im Innenhof. Freiwillige aus verschiedensten Ländern helfen bei der Arbeit, im Gegenzug erhalten sie Bett und Frühstück.
Bob ist mit sich und der Welt zufrieden. „The Maze ist der Ort, an dem wir alle die Wut und den Hass, die unser Leben verseuchen, verlieren und Frieden, Glück und Kreativität finden können“, schreibt er auf Facebook. Doch mit dem Frieden ist es bald vorbei.
Im Mai 2019 ordnen die Behörden die Schließung von The Maze an. Der Nachbar hat sie ge schmiert, vermutet Bob. Er legt Berufung ein, zunächst ergebnislos. Im Oktober wird der 76-jährige Bob samt seiner Familie „mit den Stoßtrupps“ aus dem Haus geführt und das Gebäude versiegelt. Sie finden bei Freunden Unterschlupf. „Meine beiden Kinder mussten auf dem Küchenboden schlafen. Meine Frau kauerte sich auf dem kleinen Sofa zusammen. Ich lag im einzigen Bett, weil ich die ganze Zeit krank war.“
Bob kann kaum noch gehen. In den letzten Jahren musste er bereits mehrfach ins Krankenhaus, sein Kreislauf macht schlapp. Ihm geht die Luft aus, genauso wie das Geld. „Wir hatten zwar ein Dach über dem Kopf, aber kein Einkommen mehr.“ Eine weitere Crowdfundingaktion soll Abhilfe schaffen, um die geforderten Bauarbeiten zu ermöglichen und einen Anwalt zu bezahlen. Ein Richter hebt im Frühjahr 2020 den Räumungsbeschluss wieder auf, allerdings ohne konkreten Termin. Es gibt noch einen Haken: Für die Öffentlichkeit muss das Gebäude verschlossen bleiben, bis die geforderten Bauten erledigt sind. Das gestaltet sich mehr als schwierig während der Coronapandemie. Bobs Gesundheitszustand verschlechtert sich. Als vulnerable Person isoliert er sich im Maze. Malu kommt regelmäßig vorbei, bringt das Essen und wechselt die Verbände an seinem entzündeten Bein.

Foto: Thomas Porten
Bob verbringt die einsamen Stunden damit, kleine Bilder zu malen. Er schreibt Limericks. Die „Save the Maze“Kampagne spült bis Januar 2021 immerhin 24.000 Dollar in die Kasse. Mit diesem Geld werden die Ausgänge verbreitert und die Fluchtwege neu angelegt. Die mittlerweile fertige Rollstuhlrampe erhält nun noch eine Beleuchtung und ein riesiger Wassertank wird installiert. Auch in die Gutachten für Stadt und Feuerwehr sowie die Gerichtsverfahren fließt viel Geld. Wegen seiner Arthritis kann Bob nicht mehr Gitarre spielen, und weil die Lunge es nicht mehr schafft, musste er auch das Trompetespielen aufgeben. Am Jahresende verkündet dann Rios Bürgermeister Eduardo Paes höchstpersönlich, dass The Maze bald wieder öffnen darf. Allerdings nur als Museum. Kein Restaurant und kein Bed & Breakfast. Das schmälert die Einnahmen deutlich. 10 Reales, umgerechnet etwa 1,90 Euro, verlangt Bob zum Neustart im Mai 2022 als Ein tritt. Seine Frau kümmert sich um die Führungen. „Ich bekomme ein wenig Geld von Freunden, so können wir im Moment überleben. Und ich selbst koste ja nur noch Medizin. Immerhin ist es ein verdammt guter Ort, wenn man schon das Haus nicht mehr verlassen kann.“

Foto: Thomas Porten

Foto: Thomas Porten
Die Beherbergung freiwilliger Helfer hat das Ge richt immerhin erlaubt. Und so erscheinen nach und nach neue Mosaiken an den Wänden und Böden. Bis zum Frühjahr 2023 hatte The Maze bereits 15.000 Besucher angezogen, erzählt Bob. Doch das Restaurant und die Herberge fehlen. „Das hat dem Ort viel von seinem Leben genommen“, bedauert er. Dass das Gebäude mittlerweile von der Abrissliste gestrichen wurde, beruhigt ihn kaum. „Ich habe Alphabetisierungskurse eingerichtet. Ich habe ein Gemeindezentrum gebaut. Ich habe zwei Schulen gesponsert. Ich habe verschiedene Bereiche der Gesellschaft zusammengebracht und Diskriminierung abgebaut. Ich habe unsere Gemeinde auf die Landkarte gesetzt und das Auf blühen kleiner Unternehmen ermöglicht. Und 98 das alles im Stillen! Während ich mein Leben als Künstler und Musiker, als Schriftsteller und als Schöpfer dieser MegaSkulptur und des Wahr zeichens von Rio, The Maze, weiterführte und dabei die einzige sichere und waffenfreie Ge meinschaft in Rio gründete.“ Seine Enttäuschung ist so groß wie seine Wut. „Ich habe es wirklich satt, dass diese erbärmlichen Scheißkerle, die selbst nichts leisten, nicht aufgeben, sondern nur das genießen können, was sie anderen stehlen.“ Die jahrelangen Auseinandersetzungen sind nicht spurlos an Bob vorbeigegangen. Der 79-Jährige ist des Kämpfens müde. „Ich habe nicht mehr viele Jahre“, erzählt er im Frühjahr 2023. „Aber ich wünsche mir so sehr, dass The Maze als ein ikonischer Ort überlebt. Weil es nichts Vergleichbares gibt. Es ist ein Ort, zu dem Menschen wie ich kommen, um sich zu verlieren und dann wieder selbst zu finden.“
Wenige Tage nach dem Interview stirbt Bob Nadkarni an multiplem Organversagen.
Foto: Thomas Porten
Diesen Artikel teilen