Krieg
in Schnöggersburg
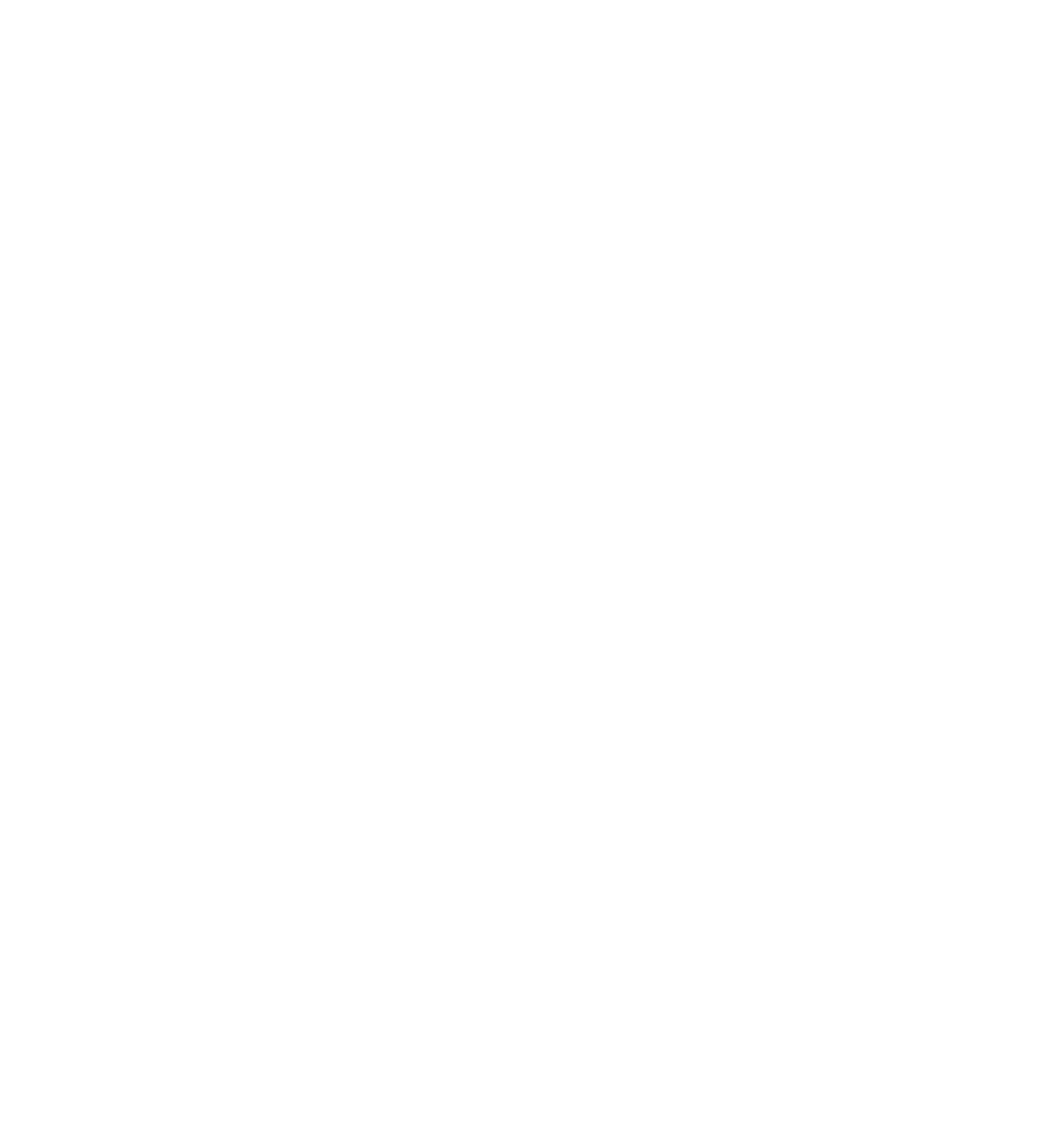
Text | Volker Thies
Fotos und Video | Michael Hertstein*
*soweit nicht anders vermerkt
Texte aus: „Zentrale Dienstanweisung Häuser- und Ortskampf“ der Deutschen Bundeswehr. In Operationen im urbanen Raum kann der Kräfteansatz in Teilen deutlich von anderen Operationen abweichen. Selbst in Kleinstädten kann der Bedarf an Kräften erheblich größer sein als in ländlichen Einsatzgebieten. Bei Offen- sivoperationen ist eine Überlegenheit von 8:1 anzustreben (5:1 ist das operative Minimum).
Krieg in Schnöggersburg
Text | Volker Thies
Fotos und Video | Michael Hertstein*
*soweit nicht anders vermerkt
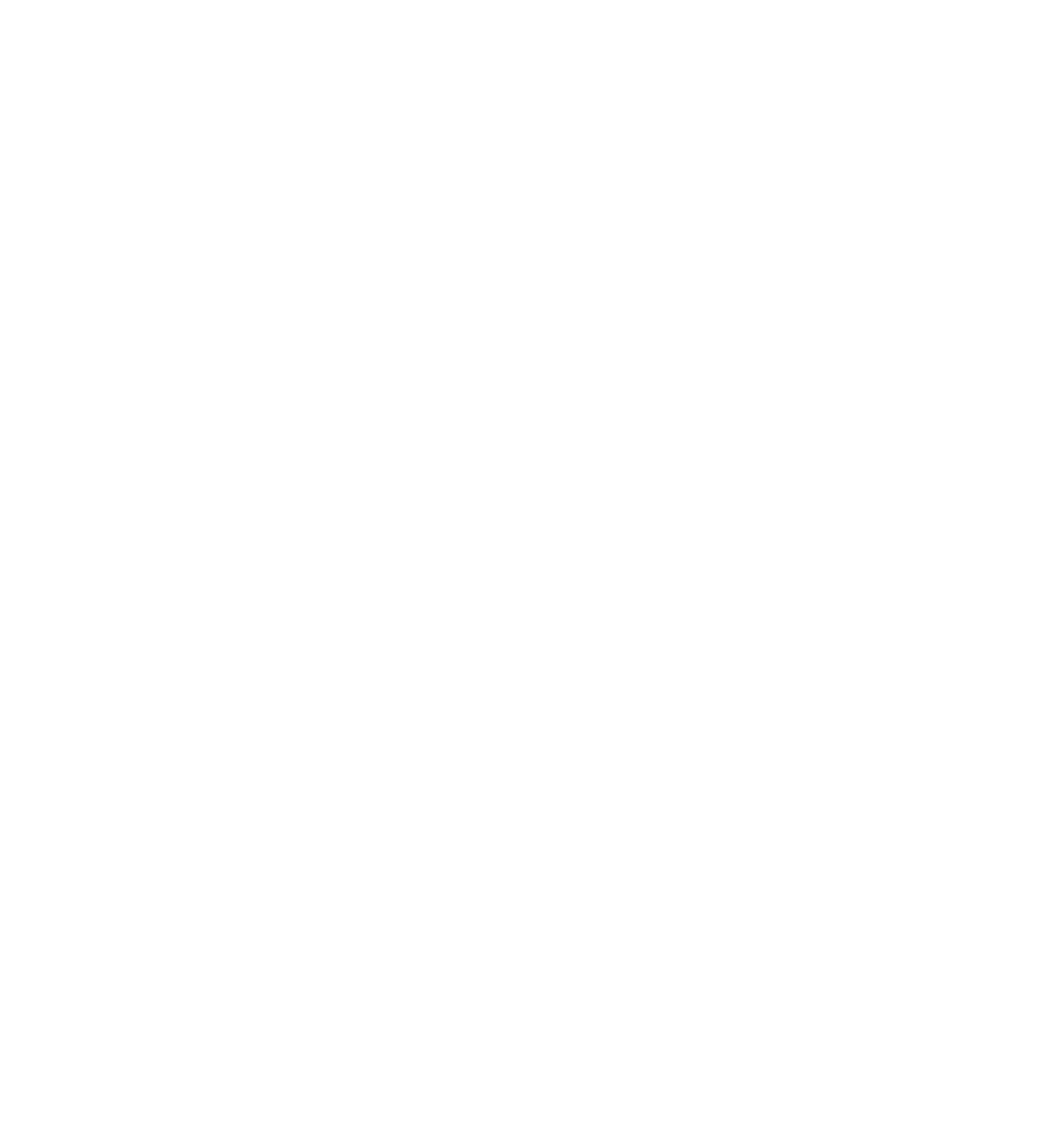
Der Ukraine-Krieg hat Europa gezeigt, dass der jahrzehntelange Friede auf dem Kontinent brüchig ist. Viele Staaten machen sich Sorgen um ihre Verteidigungsfähigkeit. Mensch und Material sollen für den Ernstfall ertüchtigt werden. Im Norden Sachsen-Anhalts gibt es eine Stadt, die nur zu diesem Zweck gebaut worden ist.
„Du bist tot.“ Wenn diese Information eintrifft, dann ist es aus. Die Kugel aus einem Sturmgewehr hat getroffen oder eine Panzergranate die Deckung durchschlagen, die man in einem der Wohnhäuser gesucht hat. Vielleicht war es auch der Scharfschütze auf dem gegenüberliegenden Dach, der von einem Zivilisten den todbringenden Tipp über das Versteck erhalten hat. Hier in Schnöggersburg gehört das Sterben zum Alltag, hier werden regelmäßig Menschen verletzt oder getötet. Denn das Städtchen mit seinen mehr als 500 Gebäuden und gut 16 Kilometer Straßen dient ausschließlich dazu, dass die Bundeswehr und ihre verbündeten Streitkräfte dort trainieren. Die Soldaten üben, wie sie ihren Gegner im urbanen Umfeld angreifen und wie sie sich selbst verhalten müssen, wenn jemand auf sie schießt. Dabei ist die Stadt auf ihren sechs Quadratkilometern eigentlich eine fast normale Ansiedlung, wie sie irgendwo auf der Welt stehen könnte, ein solides Mittelstädtchen.
Schnöggersburg umfasst ein Gewerbegebiet mit Möbelmarkt, Tankstelle und Handwerksbetrieben, aber auch noch ein paar Bauernhöfe im Umland, ein kleines Sportstadion, einen historischen Stadtkern mit verwinkelten Straßen, dazu ein Einfamilienhausgebiet, ein paar Wohnblocks, Büro- und Verwaltungsbauten. Mit Infrastruktur ist der Ort trotz seiner überschaubaren Größe reich gesegnet: Neben einem Bahn- und einem Autobahnanschluss gibt es eine U-Bahn-Linie und sogar einen kleinen Flugplatz, der zwar nur über eine unbefestigte Startbahn verfügt, dafür aber über ein richtiges Towergebäude. Man findet einen Sakralbau genauso wie einen Marktplatz und ein Elendsviertel. Was man jedoch vergeblich sucht, sind Bewohner: keine Mieter, keine Ladenbesitzer, keine Bauern und keine Schaffner. Auf den Straßen ist nur etwas los, wenn die Bundeswehr dort übt. Das tut sie häufig.
An rund 240 Tagen im Jahr wird im Gefechtsübungszentrum trainiert, die Vor- und Nachbereitungszeit nicht mitgerechnet. Bis zu 1.500 Soldatinnen und Soldaten können gleichzeitig verschiedene Szenarien durchspielen, nicht immer in Schnöggersburg selbst, aber häufig zwischen den Übungshäusern. „Unser Ziel ist es, dass jede Einheit des Heeres mindestens alle zwei Jahre bei uns ist und ihre Fähigkeiten übt und verbessert“, sagt Hauptmann Alexander Helle. Er ist Presseoffizier im Gefechtsübungszentrum Heer der Bundeswehr. Das Gefechtsübungszentrum biete Bedingungen, wie sie in ähnlicher Qualität nur an wenigen Orten auf der Welt bestehen. Für die militärische Disziplin „Orts- und Häuserkampf“ seien lediglich einige Einrichtungen der US Army und eine Übungsstadt in Israel vergleichbar.
Der Orts- und Häuserkampf gehörte schon immer zum militärischen Handwerkszeug, hat aber an Bedeutung gewonnen. „Sie brauchen nur in die Nachrichten zu schauen, dann sehen Sie, dass sich Konflikte leider zunehmend in Städten und Ansiedlungen abspielen“, sagt Helle. Das Kulissenstädtchen soll deshalb auf engem Raum möglichst alles darstellen, was Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr auf dem urbanen Gefechtsfeld begegnen könnte. „Schon heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, und der Anteil wird immer größer. Darauf müssen wir reagieren“, sagt Helle und bedient sich damit einer Aussage, die gleichlautend auch auf Konferenzen für Stadtplaner, Architekten und Immobilieninvestoren immer wieder zu hören ist.

Die infrastrukturellen Gegebenheiten begünstigen den Einsatz von Scharfschützen/Heckenschützen als Einzelschützen bis hin zum Zugrahmen in besonderer Weise. Der Kampf gegen diese ist schwierig, kräfte- und zeitraubend und kann bei Misserfolg fatale Auswirkungen auf die Moral der eigenen Truppe haben.

Bewegungen in unterirdischen Bereichen sind stets mit einer Gefahr durch Sauerstoffmangel, giftige/gesundheitsschädliche Dämpfe/Gase, einsturzgefährdete Bereiche, Stromleitungen, plötzlich ansteigenden Wasserstand, psychische und körperliche Belastung durch Enge, Atemnot, Schmutz, Tiere, Gestank, Fäkalien und Orientierungsverlust (Dunkelheit, weitreichende und verschachtelte Wegführungen) verbunden.
Die Trainingsvarianten vor Ort sind sehr vielfältig: Soldaten können ganz klassisch aus der umliegenden Heidelandschaft kommend den Angriff auf die Stadt üben. Umgekehrt kann es die Aufgabe sein, den Ort gegen eindringende Feinde zu verteidigen. Möglicherweise muss sich ein Trupp aber auch durch die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen arbeiten und steht plötzlich auf dem Marktplatz, wo in den umgebenden Häusern Feinde lauern können. Ähnlich unübersichtlich ist auch das Elendsviertel am Stadtrand, das aus übereinandergetürmten Seecontainern mit hineingeschnittenen Fenster- und Türöffnungen besteht. Ein besonders gesicherter Komplex kann je nach Übungsvorgabe das Gefängnis sein oder das Golddepot der Zentralbank von Schnöggersburg. Die Soldaten müssen unter Umständen auch überlegen, wie sie mit dem Sakralgebäude umgehen, das – je nach Szenario – eine Kirche, Moschee oder Synagoge sein kann.
Es ist zu beachten, dass der einfachste und hindernisfreiste Weg mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Bereich ist, der entweder verbarrikadiert/gesperrt oder am besten überwacht ist. Anzustreben ist beim Kampf von Haus zu Haus, dass von Giebelseite zu Giebelseite vorgegangen wird, da in der Regel auf der Giebelseite weniger Fenster sind. Foto: Bundeswehr / Mario Bähr
Bemerkenswert ist die Vielfalt der Wohnhäuser. Einzelhäuser mit Satteldach finden sich genauso wie Reihenhäuser mit Flachdach, die in Verkaufsprospekten wohl als moderne Stadtvilla bezeichnet würden. Gleiche Haustypen sind dann wieder mit verschiedenen Grundrissen gebaut. Was Bauträger eher als unnötigen Planungsaufwand ablehnen würden, ist hier eine Notwendigkeit. Schließlich sollen die Soldaten jedes einzelne Gebäude sorgfältig und aufmerksam erkunden und sich bei Angriff und Verteidigung immer wieder auf neue Situationen, Architekturen, Blickachsen und Feuerbereiche einstellen. Die Häuser sind grundsätzlich unverputzt und die Montagefugen der Modulbauelemente bleiben sichtbar. Die meisten Fenster sind zudem unverglast. Dabei wird in Schnöggersburg ohnehin während der Gefechte keine Scheibe zerstört, keine Tür gesprengt und keine Wand zertrümmert. Hier fliegt keine Panzergranate durch die Luft und keine Kugel verlässt das Gewehr. Der Krieg in Schnöggersburg wird zwar real geübt, doch Zerstörungen und Verletzungen bleiben digital.
Im Treppenaufgang wird überschlagend oder raupenartig vorgegangen (abhängig von der Breite des Treppenaufgangs). Ist ein höher gelegenes Stockwerk noch feindbesetzt, so ist die Gefahr des Einsatzes von Handgranaten durch den Gegner besonders groß. Auflockerung im Flurbereich und ein zügiges Angreifen über den Treppenaufgang sind daher besonders wichtig. Foto: Bundeswehr / Tom Twardy
Dazu wird jedes Fahrzeug, jede Handfeuerwaffe und jede Person mit Sendern und Empfängern für Laserlicht im unsichtbaren Frequenzbereich ausgestattet. Ausbildungsgerät Duellsimulator (AGDUS) heißt dieses System. Es spielt den Schiedsrichter, wenn die Soldaten mit Platzpatronen aufeinander schießen. Besonders stolz sind sie in Schnöggersburg auf das Mobile Auswertesystem Infanteristischer Einsatz, ein bundeswehrtypisches Wortungetüm, das im Alltagsgebrauch den Kosenamen MASIE trägt. Davon zu sehen sind kleine Gehäuse an den Gebäuden. Auf den ersten Blick wirken sie wie sandfarbene Nistkästen, allerdings mit mehreren vermeintlichen Einfluglöchern, die mit kleinen Spiegeln verschlossen sind. MASIE ermöglicht es, die Waffenwirkung auf Hauswände und durch sie hindurch darzustellen. Mit dem System können Lehm- oder auch Stahlbetonwände simuliert werden. Es erkennt, von welcher Waffe die Laserimpulse kommen, berechnet, welche Wirkung das Geschoss auf die Deckung und vor allem auf dahinter verschanzte Soldaten hat. Das Ergebnis fällt sehr unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sender und Empfänger sich als Panzerkanone und Lehmhütte verstehen oder ob die Wirkung eines Sturmgewehrs auf Stahlbeton berechnet wird. Diese Auswertung geht an das AGDUS-System über, das die Übungsteilnehmer am Körper tragen. „Ich bekomme dann direkt angezeigt, ob mir nichts passiert ist, ob ich eine leichte, mittlere oder schwere Verletzung habe. Wenn ich die nicht entsprechend behandele, verstärkt sich die Verletzung nach einiger Zeit – bis hin zum Ausfall. Dann bin ich tot“, erklärt Hauptmann Helle.
Aufgrund moderner Bautechnik und der verbesserten Bauweise sind die meisten (in industrialisierten Ländern) in der Nachkriegszeit errichteten großen Gebäude widerstandsfähiger gegen die Explosionswirkungen von Bomben- und Artillerieangriffen, wenngleich ein Kompletteinsturz niemals auszuschließen ist. Auch wenn moderne Gebäude leicht in Brand geraten, bleibt ihre Struktur oftmals intakt. Große Glasfronten bilden jedoch eine extreme, zusätzliche Gefährdung. Foto: Bundeswehr / Tom Twardy
Die Simulationssysteme sind über Funk vernetzt. Wenn der Übungsplatz mit voller Kapazität läuft, arbeiten rund 80 Menschen nur in der Auswertung. Die übenden Einheiten erhalten von ihnen einen detaillierten Bericht, mit dem sich das Verhalten jedes einzelnen Soldaten und Fahrzeugs in der Übungssituation nachvollziehen lässt. Das gilt auch dann, wenn es in den Untergrund geht. Dort sind die Herausforderungen noch einmal höher. Die Orientierungsmöglichkeit ist genauso eingeschränkt wie die Flexibilität in der Bewegung. In einem rund 400 Meter langen U-Bahn-Abschnitt mit seinen drei Zugängen könnte sich einerseits die Zivilbevölkerung vor Luftangriffen in Sicherheit gebracht haben. Möglicherweise hat aber auch der Übungsgegner dort Waffen oder eigene Kampfeinheiten versteckt. Ähnlich gefährlich ist es im Kanalnetz, aus dem plötzlich Feinde auftauchen können. Mit Kunstnebel und Stroboskopblitzen lassen sich Bewegung und Kampf in den Tunneln noch herausfordernder gestalten und Situationen der Orientierungslosigkeit simulieren.
Gelegentlich werden auch zivile Darsteller aus der Umgebung angeworben, um die Stadt mit Leben zu füllen. In vielen Szenarien sind Wechselwirkungen von Zivilisten und Militär vorgesehen. „Es kann in der Übung eine Rolle spielen, wer die Radiostation kontrolliert oder ob die Truppe die Wasserversorgung wiederherstellt. Entsprechend verhält sich die dargestellte Zivilbevölkerung, gibt den Soldaten Hinweise oder ist auch weniger kooperativ“, erläutert Helle. In der Regel übernimmt aber der Ausbildungsverband, der im Gefechtsübungszentrum seine Heimat hat, diese Rolle genauso wie die des Gegners der übenden Kollegen. Er hat Zugriff auf eine große Bandbreite von Fahrzeugen sowie weitere Ausrüstung. Der Ausbildungsverband kann Angriffe auf die übende Truppe simulieren oder Gebäude besetzen, die dann erobert werden müssen.

Die Bundeswehr hat diese Art der Kriegsführung in den Städten schon immer geübt, vor allem die unmittelbaren Kampfeinheiten. Im Kalten Krieg stand allerdings der befürchtete Schlagabtausch mit den Armeen des Ostblocks im Mittelpunkt, mit Panzer- und Infanterieschlachten in der norddeutschen Tiefebene oder in den Mittelgebirgen. Die Auslandseinsätze im zerfallenden Jugoslawien der 1990er und 2000er Jahre und später in Afghanistan machten dann die gewachsene Bedeutung des Orts- und Häuserkampfs deutlich. 2005 wurde schließlich der Bau der Übungsstadt Schnöggersburg im erst wenige Jahre zuvor eröffneten Gefechtsübungszentrum Heer beschlossen. Der Bau begann 2012, 2017 wurden Teile der Anlage in Betrieb genommen. Rund drei Jahre später war Schnöggersburg fertig. Die Stadt hat zusammen mit dem elektronischen Auswertungssystem rund 168 Mio. Euro gekostet. Auf der Seite des Militärs übernahmen das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr mit seinem Kompetenzzentrum Baumanagement die Planung. „Bei der Vergabe wurde darauf geachtet, so weit wie möglich Bauunternehmen und Handwerksbetriebe aus der Region zu berücksichtigen“, sagt Hauptmann Nico Hoffmann vom Bundesamt. Als ziviler Ingenieurplaner war das Büro ICL aus Leipzig beteiligt.

Ein Mindestabstand zur Zivilbevölkerung ist hier festzulegen und durchzusetzen (Absperrungen, Geländeverstärkungen, Eskalation), um u. a. der Gefahr durch den Einsatz von Waffen und Kampfmitteln auf nahe Distanz oder beispielsweise auch Selbstmordattentätern entgegentreten zu können.
Heute ist das 232 Quadratkilometer große Areal rund um Schnöggersburg einer der größten Truppenübungsplätze in Deutschland. Panzer pflügen durch das Heidegebiet der Altmark und Infanteristen üben dort Angriff und Verteidigung an Waldrändern und in Geländeeinschnitten. Tatsächlich sind das Zentrum und die zugehörige Altmark-Kaserne die ersten und bislang einzigen Bundeswehrstandorte im Inland, die seit der Wiedervereinigung komplett neu errichtet wurden, auch wenn das Übungsgelände in der Colbitz-Letzlinger Heide insgesamt eine viel längere Geschichte hat. Derzeit wird die Kaserne um zusätzliche Gebäude erweitert. Es handelt sich also um den Umkehrfall der zahlreichen Konversionen, die die Immobilienwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten beschäftigt haben.
Heute ist das 232 Quadratkilometer große Areal rund um Schnöggersburg einer der größten Truppenübungsplätze in Deutschland. Panzer pflügen durch das Heidegebiet der Altmark und Infanteristen üben dort Angriff und Verteidigung an Waldrändern und in Geländeeinschnitten. Tatsächlich sind das Zentrum und die zugehörige Altmark-Kaserne die ersten und bislang einzigen Bundeswehrstandorte im Inland, die seit der Wiedervereinigung komplett neu errichtet wurden, auch wenn das Übungsgelände in der Colbitz-Letzlinger Heide insgesamt eine viel längere Geschichte hat. Derzeit wird die Kaserne um zusätzliche Gebäude erweitert. Es handelt sich also um den Umkehrfall der zahlreichen Konversionen, die die Immobilienwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten beschäftigt haben.

Schnöggersburg und das Gefechtsübungszentrum sind zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in der landwirtschaftlich geprägten Altmark geworden. Fahrdienste, zwei Feuerwehrstandorte, Fahrzeuginstandhaltung, Verpflegung, die nötigen Büroarbeiten und auch das Management der zwei auf dem Truppenübungsplatz lebenden Wolfsrudel: All das muss erledigt werden. Insgesamt sind rund 1.600 zivile und militärische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft am Gefechtsübungszentrum beschäftigt. Die zivile Komponente des laufenden Betriebs wird jeweils für mehrere Jahre an einen Partner aus der Rüstungsindustrie ausgeschrieben. Derzeit hat Saab den Auftrag inne.

In engen Gassen und in Gebäuden sind kurze Entfernungen (Nah- und Nächstbereich der Handwaffen) und somit bis hin zum Nahkampf die Regel. Der Kampf muss unter sehr kurzen Reaktionszeiten und unter ständiger 360°-Bedrohung geführt werden. Feindliches direktes und indirektes Feuer mit Sprengmunition sowie Brände können, durch einstürzende Gebäude, Trümmer, zerrissene Versorgungsleitungen und starke Rauchentwicklung, die Verhältnisse an einem Ort schnell verändern und jede Beobachtung erschweren.

Die Berücksichtigung der Auflagen zur Schonung von Infrastruktur, administrativen Gebäuden (Rathäuser, Ministerien, Parlamente usw.) und zum Schutz von Kulturgut schränkt die Handlungsfreiheit ein. Besonders schutzbedürftige Gebäude, Einrichtungen und Anlagen sowie Schutzzonen sind in der Regel durch internationale Schutzzeichen und Symbole gekennzeichnet.
Kompetente Mitarbeiter für den Bau und Betrieb sind und waren für die Kulissenstadt unabdingbar. Denn auch wenn hier Ausnahmesituationen geübt werden, machen Baurecht und Arbeitsschutzvorschriften keine Ausnahme. Das sieht man zum Beispiel an dem kleinen Flüsschen mit dem Namen Eiser, das auf dem Gelände angelegt worden ist. An mehreren Brücken über die Eiser, bei der es sich in Wirklichkeit um ein von Regenwasser gespeistes, langgezogenes stehendes Gewässer handelt, können die Mittelabschnitte herausgefahren werden. Die Brücke gilt dann als gesprengt, so dass die Soldaten das Hindernis überwinden müssen, falls keine Panzerschnellbrücke zur Hand ist. Nachts außerhalb der unmittelbaren Übungssituation müssen die „gesprengten“ Brücken aber dann mit Gittertüren versperrt werden. Es soll schließlich niemand ins Wasser fallen oder fahren. Das Baurecht sorgt außerdem dafür, dass es auf dem Gelände keine Häuser mit mehr als sechs Stockwerken gibt – denn dann hätte ein Aufzug installiert werden müssen. „Zum Glück müssen wir wenigstens keinen Brandschutz innerhalb der Gebäude einhalten“, sagt Hoffmann. Mit der Technik für fließendes Wasser und Abwasser mussten sich die Planer auch nicht auseinandersetzen, beides gibt es nämlich nicht. Aber jedes Gebäude hat Strom, schon zum Betrieb der Simulationsanlagen. Was das Facility-Management betrifft, ist Schnöggersburg ohnehin robust und pflegeleicht. Schließlich gibt es keine Bewohner, die sich darüber beschweren, wenn nur alle paar Monate der Rasen gemäht wird. Zu den häufigsten Arbeiten gehört der Austausch von Bordsteinen: Durch den unsanften Kontakt mit Panzerketten zerbröselt nämlich gelegentlich einer. Auch die eine oder andere Straßenlaterne hat einen Rempler durch die Gefechtsfahrzeuge nicht unbeschadet überstanden. „Häuser“, so beruhigt Hoffmann, „sind aber noch nicht umgefahren worden.“

Konventionelle Gegner bereiten (meist) die Rundumverteidigung in urbanen Räumen vor. Sie verstärken ihre Truppen in befestigten und tief gestaffelten Stellungen mit Kampfpanzer, Schützenpanzer und Panzerabwehrwaffen, um – vor allem im Zuge von Durchgangsstraßen – tiefe Einbrüche zu verhindern.

Diesen Artikel teilen

