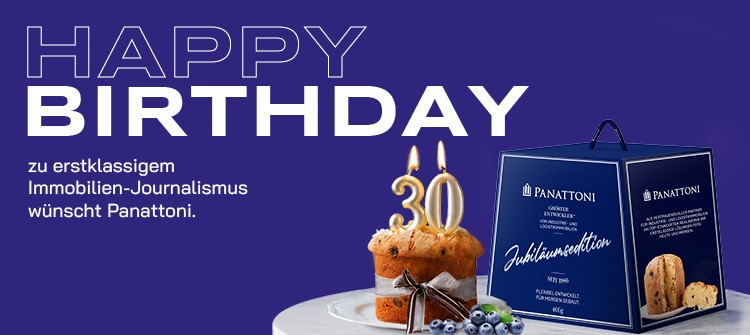Im Dorf ist Feierabend
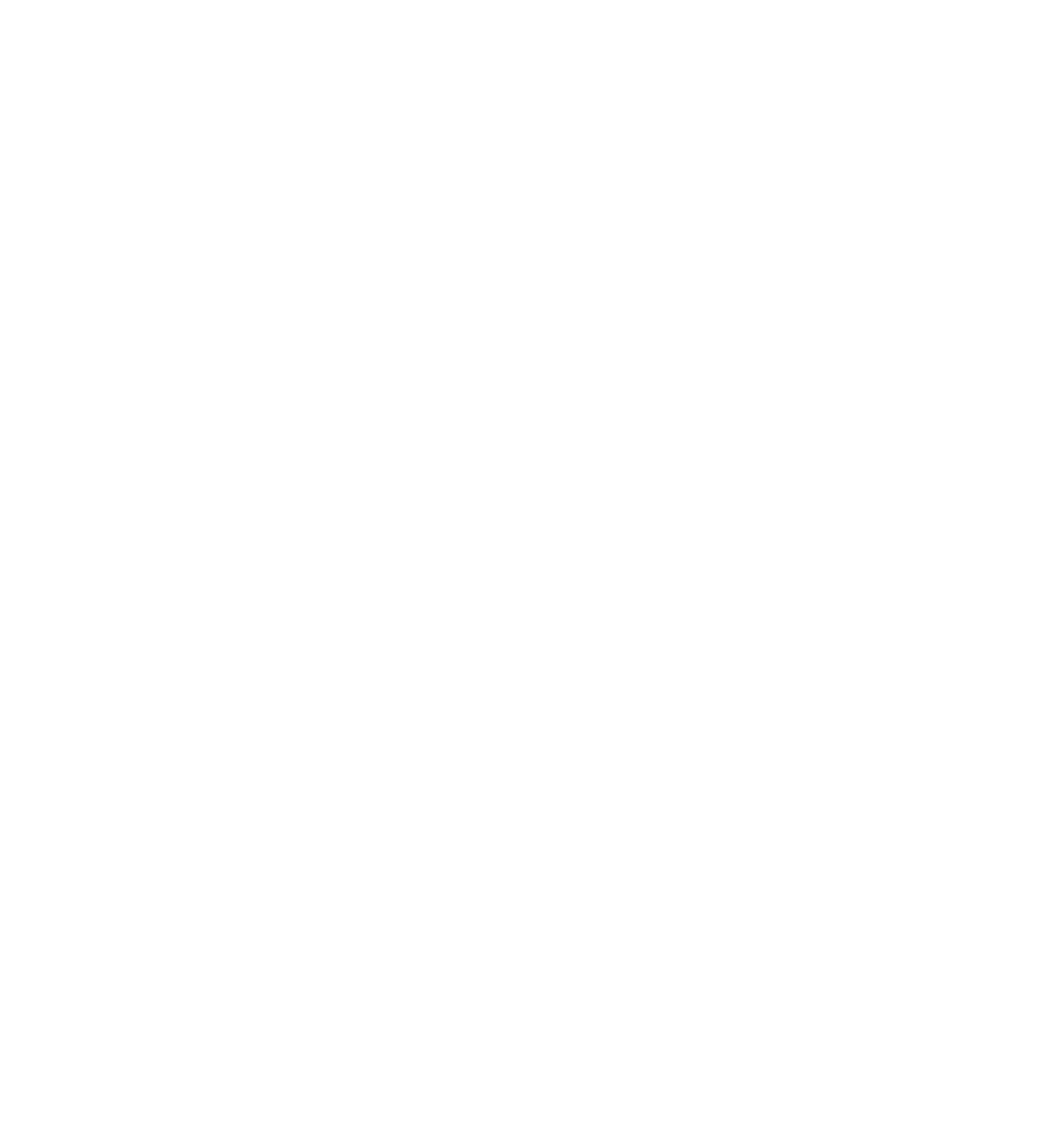
Text | Christoph von Schwanenflug, Mitarbeit: Marius Katzmann
Fotos und Video | Christof Mattes
*soweit nicht anders vermerkt

Im Dorf ist Feierabend
Text | Christoph von Schwanenflug, Mitarbeit: Marius Katzmann
Fotos | Christof Mattes
*soweit nicht anders vermerkt
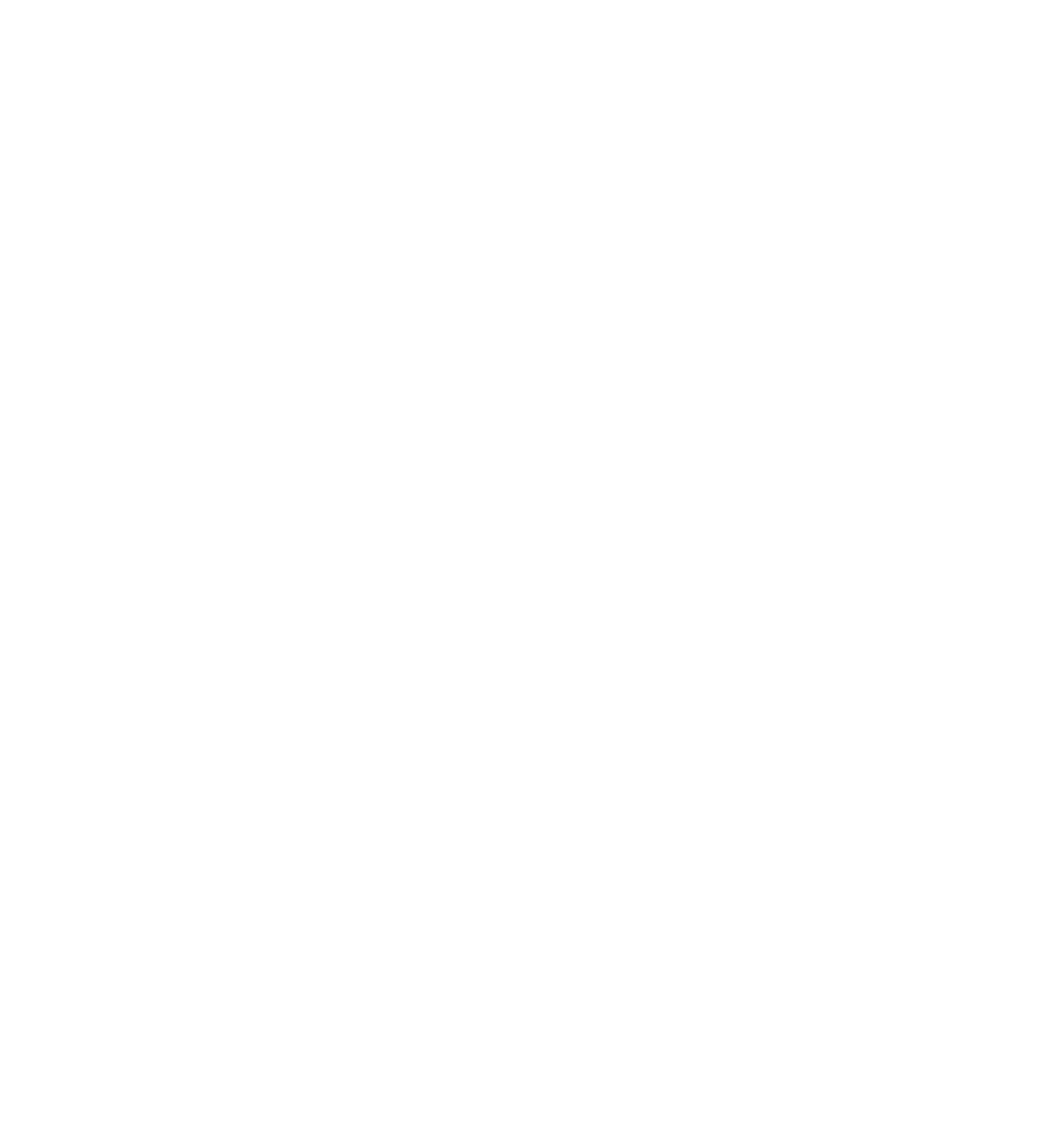
Scheitenkorb ist ein Ort mit 30 Einwohnern. Früher lebten sie dort vor allem von der Landwirtschaft. Doch die Landwirtschaft hat sich geändert und mit ihr die Menschen und ihre Häuser. Aus Bauern wurden Angestellte, aus Ställen Wohnungen. Laden oder Wirtshaus sucht man vergeblich. Das Dorfleben findet erst nach Feierabend statt.
Das Wetter ist an diesem Sonntag im April herrlich. Blauer Himmel, fast schon T-Shirt-Wetter. Von der Autobahnabfahrt Waxweiler ist es noch eine halbe Stunde bis zu unserem Ziel. Die Fahrt geht durch das enge, bewaldete Tal der Enz. Dann wieder steigt die Straße steil an und die weiten, baumlosen Höhen der Südeifel kommen zum Vorschein. Hier drehen sich die Windräder, Photovoltaikanlagen säumen unseren Weg. Bei klarem Wetter kann man am Horizont die Wasserdampfwolken aus den Kühltürmen des französischen AKW Cattenom gut erkennen. Das mittelalterliche Städtchen Neuerburg mit seiner gut erhaltenen Burganlage lassen wir links liegen. Wir sind etwas spät dran. Endlich, auf der Kreisstraße 47, kurz nach Karlshausen kommt ein Schild. „Scheitenkorb 1 km.“ Wir sind da. Eine Minute später fahren wir vor dem „Haus Kotz“ vor. Dina, die Hündin, bellt wie verrückt und lässt uns kaum aus dem Auto steigen.
Ein gutes Dutzend Gebäude, Wohneigentumsquote 100%. Kein Laden, keine Kneipe, nur eine Bushaltestelle mit Wartehäuschen, ein Briefkasten und eine Kapelle mit einem goldenen Wetterhahn auf der Turmspitze. Und einmal in der Woche kommt die Prümtaler Mühlenbäckerei mit einem Verkaufswagen vorbei. Scheitenkorb, ein Dorf in der Eifel (Rheinland-Pfalz), ist eine der kleinsten Gemeinden Deutschlands. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier, weil in Scheitenkorb genau 30 Menschen leben. Ein Ort mit 30 Menschen, eine Zeitung, die 30 Jahre alt wird. Eine naheliegende Geschichte.
Aus der Tür tritt Arnold Kotz, Jahrgang 1966, verheiratet, zwei Kinder und seit 30 Jahren der Ortsbürgermeister. Sein Gesicht und die starken Arme sind von der Arbeit auf dem Feld braun gebrannt. „Wie war die Fahrt?“ Kotz wird bei unseren Besuchen, die in den nächsten Wochen noch folgen, unser wichtigster Ansprechpartner sein, eine Art Bindeglied zwischen Zeitung und Dorfgemeinschaft. Mit ihm tauchen wir ein in das Leben eines Dorfes, das in den vergangenen Jahrzehnten sein Aussehen erheblich verändert hat. Fast alle Bauern haben ihre Betriebe aufgegeben, viele arbeiten heute in Luxemburg. Aus den ehemaligen Ställen sind Wohnhäuser geworden. Die Felder sind teilweise unter Solarpaneelen verschwunden.
„Als ich mit 27 Jahren hierhergezogen bin, waren alle Bauern. Jetzt gibt es nur noch einen.“


„Als ich mit 27 Jahren hierhergezogen bin, waren alle Bauern. Jetzt gibt es nur noch einen.“


Wir sitzen am Esstisch der Familie. Kotz kommt gleich zum Thema. „Der Hof gegenüber hat sein Vieh vor drei Jahren abgegeben.“ Er holt sein Handy heraus und ruft den aktuellen Weltmarktpreis für Weizen auf. „Hätten wir mal im Herbst per Kontrakt für 430 Euro pro Tonne verkauft“, seufzt er. „Jetzt verkaufen wir den Weizen zum Tagespreis von 270 Euro.“ Ehefrau Helga Kotz, Jahrgang 1969, serviert belegte Brote und Kaffee. „Als ich mit 27 Jahren hierhergezogen bin, waren alle Bauern. Jetzt gibt es nur noch einen.“ Sie arbeitet halbtags als Pfarrsekretärin in Neuerburg. Das Leben hat sie zur Expertin für Strukturwandel gemacht: In Neuerburg, wo sie geboren und aufgewachsen ist, gibt es fast keine Läden mehr, in Scheitenkorb, wo sie eingeheiratet hat, grassiert das Höfesterben. Ihre Kinder haben landwirtschaftsnahe Berufe ergriffen, sind aber selbst nicht Landwirte geworden. Tochter Kerstin, Jahrgang 1996, hat Tiermedizin studiert, Sohn Andreas, Jahrgang 1998, ist Mechatroniker für Land- und Baumaschinen. Beide arbeiten in Deutschland. In Scheitenkorb ist es fast schon wichtig, darauf hinzuweisen.
Arnold Kotz, Ortsbürgermeister von Scheitenkorb, erklärt im Video, welchen Einfluss Luxemburg auf das 30-Einwohner-Dorf in der Eifel hat. Video: Christoph von Schwanenflug und Marius Katzmann
Die Gegend hängt, so scheint es, wirtschaftlich am Tropf von Luxemburg, das Luftlinie kaum fünf Kilometer entfernt ist. Der Einfluss der Jobmaschine im Dreiländereck Deutschland, Belgien und Frankreich ist überall zu spüren. Der Energieversorger Encevo baut in der Verbandsgemeinde Südeifel, zu der Scheitenkorb gehört, gerade den größten Photovoltaikpark von Rheinland-Pfalz. Rund 70% des Stroms gehen nach Luxemburg. Scheitenkorb steuert zu diesem Projekt 20 ha Land bei. Luxemburger kaufen auch die aufgegebenen Höfe in Scheitenkorb. Wie zur Bestätigung piepst mein Handy. Die Telekom teilt uns mit, mit welchem Provider wir in Luxemburg telefonieren können. „In Luxemburg bekommt sogar der Baggerfahrer ein Firmenauto, damit er bleibt“, scherzt Kotz. Der Arbeitskräftemangel im Nachbarland ist notorisch. Luxemburg benötigt nicht nur Fondsmanager, Rechtsanwälte und EU-Beamte. Täglich pendeln Zehntausende von Bauarbeitern, Krankenschwestern, Verkäuferinnen, Lkw-Fahrern und Handwerkern ein.
Die Familie Kotz gab die Viehhaltung 2009 auf. In eineinhalb Jahren wurde das Stallgebäude, in dem 170 Kühe standen, in ein Wohnhaus umgebaut. Dabei fanden sich noch verkohlte Holzbalken von einem Brand Anfang des 20. Jahrhunderts. Es entstanden 200 Quadratmeter Wohnfläche inklusive einer Einliegerwohnung für Kotz’ Mutter. Das Haus ist seitdem auch das Parlamentsgebäude von Scheitenkorb: Im großzügigen Wohn- und Essbereich im ersten Stock trifft sich die siebenköpfige Gemeindevertretung.
Die Aufgabe der Milchwirtschaft war eine Vernunftentscheidung. „Mit 180 Kühen bist du heute klein“, sagt Kotz über die stetig wachsenden Betriebsgrößen in der deutschen Landwirtschaft. Statt eines Traktors parkt in seinem Hof jetzt ein weißer Transporter der Firma Lux Energie. Traktor und Mähdrescher gibt es auch noch, sie stehen in der Scheune hinter dem Haus. Nach Feierabend und am Wochenende baut Kotz mit seinem Sohn Mais, Weizen, Raps, Braugerste, Gras, Klee, Dinkel und Luzerne an, eine Nutzpflanze, die als Viehfutter verwendet wird.
Die St. Petrus-Kapelle: Ergebnis eines Lotteriegewinns.
Die Familie Kotz gab die Viehhaltung 2009 auf. In eineinhalb Jahren wurde das Stallgebäude, in dem 170 Kühe standen, in ein Wohnhaus umgebaut. Dabei fanden sich noch verkohlte Holzbalken von einem Brand Anfang des 20. Jahrhunderts. Es entstanden 200 Quadratmeter Wohnfläche inklusive einer Einliegerwohnung für Kotz’ Mutter. Das Haus ist seitdem auch das Parlamentsgebäude von Scheitenkorb: Im großzügigen Wohn- und Essbereich im ersten Stock trifft sich die siebenköpfige Gemeindevertretung.
Die Aufgabe der Milchwirtschaft war eine Vernunftentscheidung. „Mit 180 Kühen bist du heute klein“, sagt Kotz über die stetig wachsenden Betriebsgrößen in der deutschen Landwirtschaft. Statt eines Traktors parkt in seinem Hof jetzt ein weißer Transporter der Firma Lux Energie. Traktor und Mähdrescher gibt es auch noch, sie stehen in der Scheune hinter dem Haus. Nach Feierabend und am Wochenende baut Kotz mit seinem Sohn Mais, Weizen, Raps, Braugerste, Gras, Klee, Dinkel und Luzerne an, eine Nutzpflanze, die als Viehfutter verwendet wird.

Die St. Petrus-Kapelle: Ergebnis eines Lotteriegewinns.
Nach einiger Zeit wird Kotz das Sitzen zu mühsam. Der Rücken. Die Doppelbelastung – tagsüber der Job in Luxemburg, nach Feierabend die Arbeit auf dem Feld – fordert ihren Tribut. Der Arzt hat ihn krankgeschrieben. Nur deshalb hat er überhaupt Zeit für ein Interview. Er schnappt sich die Hundeleine. Zusammen mit Dina machen wir einen Spaziergang. Die 1857 erbaute St. Petrus-Kapelle steht direkt neben dem Haus. Wir blicken in einen hellen Kirchenraum, an dessen Ende ein reich vergoldeter Altar aus blau-grauem Marmor erstrahlt. Gestiftet hat das Gotteshaus ein frommer Scheitenkorber Bürger, der in einer Lotterie gewonnen hatte. Gottesdienste finden hier allerdings nur noch zweimal im Jahr statt. Rund um die Kapelle liegt der Friedhof. Auf den mustergültig gepflegten Gräbern stehen die Namen, nach denen auch die Häuser im Dorf benannt sind: Meyers, Wolter, Bonifas, Kandels, Bisenius, Dockendorf. „Früher war es bei uns so, dass die Nachbarn das Grab für einen Toten ausgehoben haben.“ Früher – wie oft fällt dieses Wort während unserer insgesamt vier Besuche in Scheitenkorb?
Zweimal im Jahr wird hier Gottesdienst gefeiert.
Nach einiger Zeit wird Kotz das Sitzen zu mühsam. Der Rücken. Die Doppelbelastung – tagsüber der Job in Luxemburg, nach Feierabend die Arbeit auf dem Feld – fordert ihren Tribut. Der Arzt hat ihn krankgeschrieben. Nur deshalb hat er überhaupt Zeit für ein Interview. Er schnappt sich die Hundeleine. Zusammen mit Dina machen wir einen Spaziergang. Die 1857 erbaute St. Petrus-Kapelle steht direkt neben dem Haus. Wir blicken in einen hellen Kirchenraum, an dessen Ende ein reich vergoldeter Altar aus blau-grauem Marmor erstrahlt. Gestiftet hat das Gotteshaus ein frommer Scheitenkorber Bürger, der in einer Lotterie gewonnen hatte. Gottesdienste finden hier allerdings nur noch zweimal im Jahr statt. Rund um die Kapelle liegt der Friedhof. Auf den mustergültig gepflegten Gräbern stehen die Namen, nach denen auch die Häuser im Dorf benannt sind: Meyers, Wolter, Bonifas, Kandels, Bisenius, Dockendorf. „Früher war es bei uns so, dass die Nachbarn das Grab für einen Toten ausgehoben haben.“ Früher – wie oft fällt dieses Wort während unserer insgesamt vier Besuche in Scheitenkorb?

Zweimal im Jahr wird hier Gottesdienst gefeiert.
„Auf dem Höhepunkt hatten wir 150 Tiere.“
Früher Ackerbauern, jetzt Sonnenbauern: Oswald Diederich (links) mit Frau Monika und Sohn Jürgen.
„Auf dem Höhepunkt hatten wir 150 Tiere.“
Früher Ackerbauern, jetzt Sonnenbauern: Oswald Diedrich (links) mit Frau Monika und Sohn Jürgen.
Der Wind bläst so heftig, dass wir die Gespräche, die wir mit dem Smartphone aufzeichnen, später kaum noch verstehen können. In der Ferne drehen sich drei Windräder, darunter glitzern mit Solarpaneelen überzogene Bergrücken in der Sonne, als seien sie ein Gewässer. Kotz hat Recht. „Die Energiewende wird in der Stadt beschlossen, aber auf dem Land umgesetzt.“ Wir erfahren, dass in manchen Bäumen noch Granatsplitter aus dem Zweiten Weltkrieg stecken. Direkt an Scheitenkorb lief der Westwall vorbei. „Wir haben hier noch einen alten Lagerstollen und Schutzstollen für die Bevölkerung. Der ist noch erhalten. Da sind jetzt die Fledermäuse eingezogen.“ Kurze Zeit später stehen wir vor einem vergitterten Tunneleingang. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs war Kotz schon einmal hier. Mit Vertretern der Bundeswehr. Sie wollten nachsehen, ob man den Stollen im Fall der Fälle noch benutzen könne.
Auf dem Rückweg zum Dorf entsteht dann die Idee: Wir veranstalten ein Grillfest! Die Immobilien Zeitung spendiert Fleisch und Bier, der Bürgermeister trommelt die Bevölkerung zusammen. So können wir auf zwanglose Weise weitere Dorfbewohner kennenlernen – für die Scheitenkorber dagegen ist es eine Gelegenheit, mal wieder zusammenzusitzen. Denn so oft wie vor 30 Jahren, als es noch sieben Bauern gab, sieht man sich nicht mehr. Scheitenkorb ist heute ein Nach-Feierabend-Dorf. Nur eine Familie hält die Fahne der Landwirtschaft noch hoch, die anderen pendeln tagsüber alle weg. Am 10. Juni ist es so weit. Wir fahren frühmorgens in Wiesbaden los. Das Fleisch holen wir bei Batz in Arzfeld, eine der letzten Metzgereien in der Gegend, die Getränke bei Bonefas in Lünebach, wo sich die Bitburger-Kästen im Hof türmen. Als wir um die Mittagszeit ankommen, sind der Grill, Brot und verschiedene Salate in der Garage schon aufgebaut. Das Fest kann beginnen.
Bis zum Nachmittag sind etwa zwei Drittel der Dorfbewohner gekommen. Der ehemalige Bauer Oswald Diederich mit seiner Frau Monika, die lange ein Hospiz geleitet hat. Sohn Jürgen, der als Landmaschinenmechaniker in Luxemburg arbeitet, mit seiner Tochter Marie und Frau Sabrina, die im Nachbarort Karlshausen eine Stelle im Kindergarten hat. Simone Meiers, die aus Sachsen kommt und noch nie eine Kuh angefasst hatte, bevor sie nach Scheitenkorb zog. Hermann Meiers, ihr Mann. Er wurde durch eine Schulterverletzung berufsunfähig, gab 2015 die Viehhaltung auf, investiert heute in Immobilien und verpachtet Flächen für Photovoltaikanlagen. Seine Mutter Kordula Meiers.
Die Schülerinnen Amy Zeus und Joyce Faber. Ihre Mutter Natascha Bill aus Luxemburg hat vor zwei Jahren einen heruntergekommenen Hof gekauft. Karsten Skrzys ist gekommen, der mit seiner Frau aus Nordrhein-Westfalen zugezogen ist. Andreas Kotz, der Sohn des Bürgermeisters, und seine Schwester Kerstin Malambre, die Tierärztin, sind auch da. Und schließlich Wolfgang Thiex, 1. Beigeordneter und Jagdvorsteher von Scheitenkorb. Er wohnt nebenan im „Haus Falz“. Es war sein Ururonkel, der die Kapelle gestiftet hat.

Bis zum Nachmittag sind etwa zwei Drittel der Dorfbewohner gekommen. Der ehemalige Bauer Oswald Diederich mit seiner Frau Monika, die lange ein Hospiz geleitet hat. Sohn Jürgen, der als Landmaschinenmechaniker in Luxemburg arbeitet, mit seiner Tochter Marie und Frau Sabrina, die im Nachbarort Karlshausen eine Stelle im Kindergarten hat. Simone Meiers, die aus Sachsen kommt und noch nie eine Kuh angefasst hatte, bevor sie nach Scheitenkorb zog. Hermann Meiers, ihr Mann. Er wurde durch eine Schulterverletzung berufsunfähig, gab 2015 die Viehhaltung auf, investiert heute in Immobilien und verpachtet Flächen für Photovoltaikanlagen. Seine Mutter Kordula Meiers.
Die Schülerinnen Amy Zeus und Joyce Faber. Ihre Mutter Natascha Bill aus Luxemburg hat vor zwei Jahren einen heruntergekommenen Hof gekauft. Karsten Skrzys ist gekommen, der mit seiner Frau aus Nordrhein-Westfalen zugezogen ist. Andreas Kotz, der Sohn des Bürgermeisters, und seine Schwester Kerstin Malambre, die Tierärztin, sind auch da. Und schließlich Wolfgang Thiex, 1. Beigeordneter und Jagdvorsteher von Scheitenkorb. Er wohnt nebenan im „Haus Falz“. Es war sein Ururonkel, der die Kapelle gestiftet hat.
Thiex, wie Bürgermeister Kotz ein 1966er Jahrgang, tickt ganz anders als sein Nachbar. Während dieser die Landwirtschaft im Nebenerwerb aufrechterhält, und sei es nur, um seinem Sohn die Möglichkeit der Übernahme nicht zu verbauen, bedauert Thiex, nicht schon viel früher aufgehört zu haben. Die Landwirtschaft ist in seinen Augen nur noch ein „teures Hobby“, er hat alle seine Felder verpachtet. Im Hauptberuf fährt er seit 2007 Lkw für einen Landhandel in Luxemburg. Trotzdem sagt er noch immer „wir“, wenn er den Bauernstand gegen die in seinen Augen unsinnigen Vorschriften und Gängelungen der Politik verteidigt.
Thiex ist unverheiratet und hat keine Kinder. Er wohnt mehr oder weniger noch so, wie er das Haus von seinen Eltern übernommen hat. Für wen sollte er auch umbauen? „Mit mir läuft es aus.“ Was aus dem Ende des 18. Jahrhunderts erbauten Hof mit einem denkmalgeschützten, 150 Jahre alten Kastanienbaum vor der Tür einmal werden wird, ist offen. „Bis jetzt lebe ich gut hier.“
Ganz zum Schluss erscheint die Familie B. aus Luxemburg. Erst vor wenigen Wochen haben sie das „Haus Schilz“ gekauft, ein Wohngebäude mit zwei Etagen, 190 Quadratmeter Wohnfläche, zwei Hektar Grundstück, Hühnern und einer Halle. Tochter Lara studiert Heilpädagogik, sie möchte aus dem Anwesen einen therapeutischen Bauernhof machen. Ein wenig schüchtern kommt die Familie auf ihre neuen Nachbarn zu. Es ist das erste Mal, dass die Luxemburger Neubürger auf die Dorfgemeinschaft treffen.
„Bis jetzt lebe ich gut hier.“
Thiex, wie Bürgermeister Kotz ein 1966er Jahrgang, tickt ganz anders als sein Nachbar. Während dieser die Landwirtschaft im Nebenerwerb aufrechterhält, und sei es nur, um seinem Sohn die Möglichkeit der Übernahme nicht zu verbauen, bedauert Thiex, nicht schon viel früher aufgehört zu haben. Die Landwirtschaft ist in seinen Augen nur noch ein „teures Hobby“, er hat alle seine Felder verpachtet. Im Hauptberuf fährt er seit 2007 Lkw für einen Landhandel in Luxemburg. Trotzdem sagt er noch immer „wir“, wenn er den Bauernstand gegen die in seinen Augen unsinnigen Vorschriften und Gängelungen der Politik verteidigt.
Thiex ist unverheiratet und hat keine Kinder. Er wohnt mehr oder weniger noch so, wie er das Haus von seinen Eltern übernommen hat. Für wen sollte er auch umbauen? „Mit mir läuft es aus.“ Was aus dem Ende des 18. Jahrhunderts erbauten Hof mit einem denkmalgeschützten, 150 Jahre alten Kastanienbaum vor der Tür einmal werden wird, ist offen. „Bis jetzt lebe ich gut hier.“
Ganz zum Schluss erscheint die Familie B. aus Luxemburg. Erst vor wenigen Wochen haben sie das „Haus Schilz“ gekauft, ein Wohngebäude mit zwei Etagen, 190 Quadratmeter Wohnfläche, zwei Hektar Grundstück, Hühnern und einer Halle. Tochter Lara studiert Heilpädagogik, sie möchte aus dem Anwesen einen therapeutischen Bauernhof machen. Ein wenig schüchtern kommt die Familie auf ihre neuen Nachbarn zu. Es ist das erste Mal, dass die Luxemburger Neubürger auf die Dorfgemeinschaft treffen.
„Bis jetzt lebe ich gut hier.“
„Früher war Arbeit von fünf bis elf.“
Wir lernen auch Elfriede Kotz kennen, die Mutter des Bürgermeisters. Sie sitzt an die Hauswand gelehnt auf einer Bank und scheint noch nicht genau zu wissen, was sie von diesem Grillfest halten soll. „Früher hätten wir hier nicht sitzen können, die Hauswand und der Boden waren schwarz vor Fliegen“, beginnt sie. Die Fliegen! Als überall in den Ställen noch Kühe standen, war das die große Plage von Scheitenkorb. Heute ist der Ort mehr oder weniger fliegenfrei. Dafür gibt es aber auch kaum noch Schwalben, und das bedauert Elfriede Kotz sehr.
Sie ist die älteste Einwohnerin von Scheitenkorb, die auch hier geboren wurde. Sie hat den großen Sturm erlebt, der Scheitenkorb 1990 heimsuchte und in Nullkommanichts das Kirchendach abdeckte. 1938 kam sie im „Haus Kessels“ zur Welt. Ihr Vater brach das Feld noch mit Pferden und Ochsen um, wie „pflügen“ in der Eifel heißt. Den Pflug gibt es immer noch, er steht vor ihrer Einliegerwohnung. Wie ein Museumsstück.
Beim Rundgang über den Hof frage ich sie, ob sie das Leben früher besser fand. „Früher war Arbeit von fünf bis elf“, antwortet sie. Melken, Kinder fertig machen, das Vieh auf die Weide treiben, Hausarbeit, Feldarbeit. Aber man sei sein eigener Herr gewesen. Das „Geld“ von heute sei aber auch nicht zu verachten. Und noch etwas hebt die Dorfälteste hervor: Es gebe weniger Kinder. „Als Arnold ein Junge war, hatten wir hier eine ganze Fußballmannschaft.“
„Früher war Arbeit von fünf bis elf.“
Wir lernen auch Elfriede Kotz kennen, die Mutter des Bürgermeisters. Sie sitzt an die Hauswand gelehnt auf einer Bank und scheint noch nicht genau zu wissen, was sie von diesem Grillfest halten soll. „Früher hätten wir hier nicht sitzen können, die Hauswand und der Boden waren schwarz vor Fliegen“, beginnt sie. Die Fliegen! Als überall in den Ställen noch Kühe standen, war das die große Plage von Scheitenkorb. Heute ist der Ort mehr oder weniger fliegenfrei. Dafür gibt es aber auch kaum noch Schwalben, und das bedauert Elfriede Kotz sehr.
Sie ist die älteste Einwohnerin von Scheitenkorb, die auch hier geboren wurde. Sie hat den großen Sturm erlebt, der Scheitenkorb 1990 heimsuchte und in Nullkommanichts das Kirchendach abdeckte. 1938 kam sie im „Haus Kessels“ zur Welt. Ihr Vater brach das Feld noch mit Pferden und Ochsen um, wie „pflügen“ in der Eifel heißt. Den Pflug gibt es immer noch, er steht vor ihrer Einliegerwohnung. Wie ein Museumsstück.
Beim Rundgang über den Hof frage ich sie, ob sie das Leben früher besser fand. „Früher war Arbeit von fünf bis elf“, antwortet sie. Melken, Kinder fertig machen, das Vieh auf die Weide treiben, Hausarbeit, Feldarbeit. Aber man sei sein eigener Herr gewesen. Das „Geld“ von heute sei aber auch nicht zu verachten. Und noch etwas hebt die Dorfälteste hervor: Es gebe weniger Kinder. „Als Arnold ein Junge war, hatten wir hier eine ganze Fußballmannschaft.“
Nur eine Gruppe fehlt auf diesem Grillfest: die Familie B., die letzten im Dorf, die Milchwirtschaft betreiben. Gäbe es die B.s nicht, würde man in Scheitenkorb gar keine Kühe mehr sehen. An einem Gespräch haben sie aber kein Interesse und auf ein irgendwie geartetes Heile-Welt-Foto mit den anderen Dorfbewohnern schon gar nicht. „Sie hätten sich ein anderes Dorf aussuchen sollen“, sagt uns die Bäuerin. Zum Dorf hat sie offenbar ein sehr distanziertes Verhältnis. „Scheitenkorb ist da, wo unser Betrieb ist. Wäre der Betrieb woanders, wären wir dort.“

Die neue Attraktion: ein Militärlaster aus dem Zweiten Weltkrieg.
Mittlerweile hat das Fest an Fahrt aufgenommen. Die Kinder spielen Karten, die Gespräche der Erwachsenen drehen sich um die Landwirtschaft. Wolfgang Thiex stichelt gegen die biologische Landwirtschaft. „Wussten Sie, dass auch Bio-Kühe mit Antibiotika behandelt werden?“, fragt er mich. Kotz’ Tochter, die Tierärztin, schaltet sich ein. Das sei zwar richtig, allerdings dürfe die Milch dieser Kühe erst nach 56 Tagen wieder als Bio-Milch verkauft werden. Bei konventioneller Viehhaltung seien die Bestimmungen weniger streng.
Während sich Thiex noch über die Verordnung lustig macht, biegt plötzlich ein olivgrüner amerikanischer Militärlaster aus dem Zweiten Weltkrieg in den Hof ein. Marschieren jetzt etwa die Amerikaner wieder in Scheitenkorb ein wie schon einmal 1945? Nein, es ist nur Herr B. aus Luxemburg, der den neuen Nachbarn ein Prachtexemplar aus seiner Sammlung von historischen Fahrzeugen vorführen will. Innerhalb weniger Augenblicke haben sich die Männer um den tipptopp restaurierten Laster versammelt. Herr B. öffnet die Kühlerhaube. Er wird, so viel ist klar, nie mehr ein Fremder in Scheitenkorb sein.
Es beginnt zu dämmern. Oswald Diederich kommt auf uns zu. „Wollen Sie auch mal unser Haus sehen?“ Der ehemalige Hof der Diederichs liegt am Ortsrand. Als wir ankommen, geht gerade die Sonne unter. Diederich gab die Landwirtschaft schon 2002 wegen einer Herzkrankheit auf. Sein Sohn führte den Hof noch eine Zeitlang neben seinem Hauptberuf weiter. Das endgültige Aus kam 2016 sehr plötzlich. „Ich hatte eine OP, mein Sohn war auf einem Lehrgang.“ Von einem Tag auf den anderen war niemand mehr da, der sich um das Vieh kümmern konnte. Ende Februar 2016, auf den genauen Tag können sich Vater und Sohn nicht mehr einigen, wurden die Tiere abgeholt. „Da war leer.“

In Scheitenkorb werden u.a. Mais, Weizen und Braugerste angebaut.
Wenn Sohn Jürgen wollte, könnte er den Ackerbau wohl jederzeit wieder anfangen. Der gesamte Maschinenpark, der für die Landwirtschaft nötig ist, steht in einer imposanten neuen Halle hinter dem Haus. Auch Oswald Diederich hat den ehemaligen Kuhstall in ein Wohnhaus umgebaut. Zweigeschossig, mit Holzbank und Tisch, Blumenkübeln und einem Springbrunnen davor. Der Sohn hat nebenan neu gebaut – ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage. An dieser Stelle sieht Scheitenkorb tatsächlich schon aus wie ein Neubaugebiet.

Die „Ranch“ von Natascha Bill und Mouton Loïk.

Der wöchentliche Besuch der Prümtaler Mühlenbäckerei.
Am nächsten Morgen treffen wir Natascha Bill aus Luxemburg. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Mouton Loïk kaufte sie 2021 für rund 270.000 Euro einen Hof mit Wohnhaus, Schafen und einem Traktor. In den letzten zweieinhalb Jahren hat das Paar aus dem heruntergekommenen Betrieb eine kleine Ranch gemacht – mit Pferdestall, Reitplatz, Paddock, Weidezelt und einem Swimmingpool. Die Verwirklichung ihres Traums, ein Stall für Pensionspferde und Freizeitreiter, finanzieren sie mit ihren Jobs in Luxemburg: Bill arbeitet als Krankenpflegerin, ihr Freund in einem Dressurstall. Da, wo sie herkommen, wäre ein solches Projekt utopisch gewesen, sagt Loïk. „Für so etwas bezahlst du in Luxemburg Millionen.“
Mit dem Besuch bei Natascha Bill endet die Mission Scheitenkorb. Wir haben ein Dorf kennengelernt, dessen Bewohner sich permanent an den Strukturwandel anpassen. Sie verkaufen ihr Vieh, verpachten ihr Land, ergreifen andere Berufe und bauen neue Häuser. Manche wie Bürgermeister Kotz versuchen, die alte und die neue Welt unter einen Hut zu bringen. Sie gehen in Luxemburg arbeiten, sitzen während der Erntezeit aber trotzdem noch bis drei Uhr früh auf dem Mähdrescher. Gerade ist Photovoltaik das große Ding. An die Stelle von Kühen treten die Pferde für Freizeitreiter. Und noch etwas fällt auf: Immer geht es in den Gesprächen um Land. Wie es genutzt wird, was es wert ist, wer wie viel hat und ob es jemandem gehört oder nur gepachtet ist.

Natascha Bill und Mouton Loïk mit ihren Pferden.
Mit dem Besuch bei Natascha Bill endet die Mission Scheitenkorb. Wir haben ein Dorf kennengelernt, dessen Bewohner sich permanent an den Strukturwandel anpassen. Sie verkaufen ihr Vieh, verpachten ihr Land, ergreifen andere Berufe und bauen neue Häuser. Manche wie Bürgermeister Kotz versuchen, die alte und die neue Welt unter einen Hut zu bringen. Sie gehen in Luxemburg arbeiten, sitzen während der Erntezeit aber trotzdem noch bis drei Uhr früh auf dem Mähdrescher. Gerade ist Photovoltaik das große Ding. An die Stelle von Kühen treten die Pferde für Freizeitreiter. Und noch etwas fällt auf: Immer geht es in den Gesprächen um Land. Wie es genutzt wird, was es wert ist, wer wie viel hat und ob es jemandem gehört oder nur gepachtet ist.

Natascha Bill und Mouton Loïk mit ihren Pferden.
„Die Landwirtschaft ist nur ein teures Hobby.“
In Scheitenkorb gibt es nur noch einen Vollerwerbslandwirt.
Wären wir vor 30 Jahren hier gewesen, hätte Scheitenkorb ganz anders auf uns gewirkt: Aus einem halben Dutzend Ställen hätten Kühe gebrüllt. Es hätte auch noch Schweine gegeben. Die Straßen wären voller Dreck gewesen, Schwalben wären in den Ställen ein- und ausgeflogen, Fliegen hätten Mensch und Tier geplagt. Heute sind die Straßen sauber. Scheitenkorb, 276 Hektar groß, wandelt sich zu einem Ort, in dem sich Menschen ihren Traum vom Immobilieneigentum erfüllen können. In diesem Punkt ist es ein Dorf wie viele andere.

Aus Sachsen in die Eifel: Simone Meier mit Ehemann Hermann.
Wir schauen zum Abschied noch einmal bei Bürgermeister Kotz vorbei. Bis halb eins in der Früh hätten sie gestern noch gesessen, erzählt er. Er scheint zufrieden zu sein. Auch wenn nicht alle dabeigewesen sind, das Dorf ist mal wieder zusammengekommen und hat sich ausgetauscht. Kotz gibt uns ein Buch zurück, das wir ihm geliehen hatten, weil wir dachten, es könne ihn interessieren. „Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben“ von Ewald Frie. Eines der am meisten verkauften Sachbücher des Jahres 2023. Er verliert kein Wort darüber. Vielleicht ist die Geschichte, die da erzählt wird, zu nah dran an seinem eigenen Leben.
Zurück in Wiesbaden hören wir uns an, wie der Bürgermeister die Zukunft von Scheitenkorb sieht. „Früher war Scheitenkorb ein Arbeits- und Wohnort. Da war tagsüber immer viel Betrieb im Dorf. Man hat auch mehr Leute gesehen. Das fängt jetzt abends nach 18 Uhr an. Dann ist jeder von der Arbeit zurück. Da hat jeder sein Projekt, das er durchzieht. Deswegen denke ich, dass wir mehr ein Wohnort werden. Zwar nicht so, wie man das in der Stadt kennt. Aber eben nach Feierabend.“
Generationentreff beim Grillfest.
Wir schauen zum Abschied noch einmal bei Bürgermeister Kotz vorbei. Bis halb eins in der Früh hätten sie gestern noch gesessen, erzählt er. Er scheint zufrieden zu sein. Auch wenn nicht alle dabeigewesen sind, das Dorf ist mal wieder zusammengekommen und hat sich ausgetauscht. Kotz gibt uns ein Buch zurück, das wir ihm geliehen hatten, weil wir dachten, es könne ihn interessieren. „Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben“ von Ewald Frie. Eines der am meisten verkauften Sachbücher des Jahres 2023. Er verliert kein Wort darüber. Vielleicht ist die Geschichte, die da erzählt wird, zu nah dran an seinem eigenen Leben.
Zurück in Wiesbaden hören wir uns an, wie der Bürgermeister die Zukunft von Scheitenkorb sieht. „Früher war Scheitenkorb ein Arbeits- und Wohnort. Da war tagsüber immer viel Betrieb im Dorf. Man hat auch mehr Leute gesehen. Das fängt jetzt abends nach 18 Uhr an. Dann ist jeder von der Arbeit zurück. Da hat jeder sein Projekt, das er durchzieht. Deswegen denke ich, dass wir mehr ein Wohnort werden. Zwar nicht so, wie man das in der Stadt kennt. Aber eben nach Feierabend.“

Generationentreff beim Grillfest.
„Ein Wohnort, aber erst nach Feierabend.“
Diesen Artikel teilen